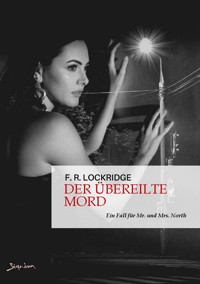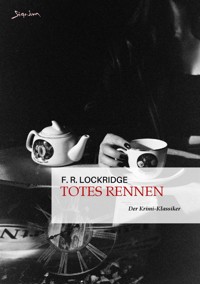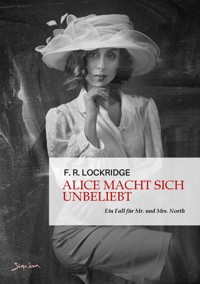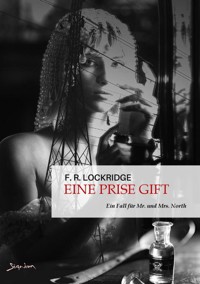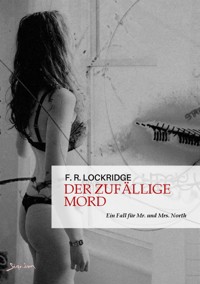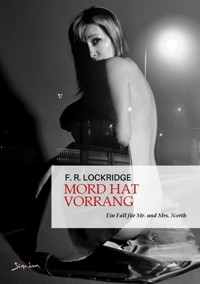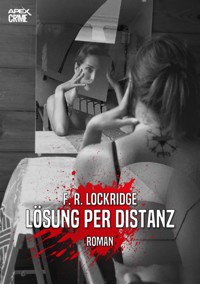5,99 €
Mehr erfahren.
Sie wachte an diesem Morgen des letzten Tages im März als erste auf. Es war nicht mehr sehr früh, das sah sie am Licht, und sie sah daraus auch, dass wieder die Sonne schien. Morgen wird es früh sein, dachte sie, denn morgen ist der letzte Tag. Morgen werden wir es eilig haben, werden Schubladen und Regale untersuchen, ob auch nichts vergessen worden ist, ehe wir zum letzten Mal die Tür zu einem vertraut gewordenen Zimmer schließen, auf eine Terrasse treten, die unsere Terrasse geworden ist, eine Treppe hinuntersteigen und zum letzten Mal den Wagen aus dem Parkplatz fahren und zur Straße hin wenden.
Das wird morgen sein, dachte sie. Heute ist unser letzter Tag.
Der Roman Jeden Abend um sechs von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1961; eine deutsche Erstveröffentlichung folgte 1963.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
Jeden Abend um sechs
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
JEDEN ABEND UM SECHS
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Das Buch
Sie wachte an diesem Morgen des letzten Tages im März als erste auf. Es war nicht mehr sehr früh, das sah sie am Licht, und sie sah daraus auch, dass wieder die Sonne schien. Morgen wird es früh sein, dachte sie, denn morgen ist der letzte Tag. Morgen werden wir es eilig haben, werden Schubladen und Regale untersuchen, ob auch nichts vergessen worden ist, ehe wir zum letzten Mal die Tür zu einem vertraut gewordenen Zimmer schließen, auf eine Terrasse treten, die unsere Terrasse geworden ist, eine Treppe hinuntersteigen und zum letzten Mal den Wagen aus dem Parkplatz fahren und zur Straße hin wenden.
Das wird morgen sein, dachte sie. Heute ist unser letzter Tag.
Der Roman Jeden Abend um sechs von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1961; eine deutsche Erstveröffentlichung folgte 1963.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
JEDEN ABEND UM SECHS
Erstes Kapitel
Sie wachte an diesem Morgen des letzten Tages im März als erste auf. Es war nicht mehr sehr früh, das sah sie am Licht, und sie sah daraus auch, dass wieder die Sonne schien. Morgen wird es früh sein, dachte sie, denn morgen ist der letzte Tag. Morgen werden wir es eilig haben, werden Schubladen und Regale untersuchen, ob auch nichts vergessen worden ist, ehe wir zum letzten Mal die Tür zu einem vertraut gewordenen Zimmer schließen, auf eine Terrasse treten, die unsere Terrasse geworden ist, eine Treppe hinuntersteigen und zum letzten Mal den Wagen aus dem Parkplatz fahren und zur Straße hin wenden.
Das wird morgen sein, dachte sie. Heute ist unser letzter Tag. Sie schlug das Laken zurück, und die warme Luft strich sanft über ihren Körper. Ich bin sehr braun geworden, dachte sie; ich bin noch nie so braun' gewesen. Das Rauschen der Brandung klingt schwach heute; unser letzter Tag wird ein schöner Tag werden.
Ich werde jetzt ganz leise aufstehen, sagte sie zu sich, und zum Fenster gehen und durch die Ritzen der Jalousie hinaus aufs Meer schauen. Die Sonne wird auf dem Wasser glitzern. Und obwohl ich kein Geräusch gemacht haben werde, wird er wach sein, wenn ich mich umdrehe, und mich anschauen, und ich werde wieder überrascht sein, wie blau seine Augen sind.
Sie ging geräuschlos, auf bloßen Füßen, über den Teppich. Sie fasste die Jalousie nicht an, damit sie nicht klapperte. Das Sonnenlicht tanzte auf der endlosen Wasserfläche. Dann drehte sie sich um, und er schaute sie an, und sie lächelte und dachte dabei, wie blau seine Augen seien.
»Komm her«, sagte er. Sie ging hin.
»Du machst guten Kaffee«, erklärte er ihr, als sie beim Frühstück saßen. »Du kannst gut Eier kochen. Du bist sehr schön, ich hab’ dich sehr lieb.«
»Jeder«, antwortete sie ihrem Mann, »kann Eier kochen.«
»Beinahe niemand«, widersprach er. »Es ist sehr schwer, ein Ei zu kochen. Was wollen wir heute tun?«
»Was wir gestern getan haben«, sagte sie. »Was wir vorgestern getan haben. Nur - alles ein bisschen langsamer.«
»Vielleicht«, meinte er. »Wie es sich gerade ergibt.«
»Es ist, als ob dieses Zimmer eine Art Haus wäre«, sagte sie. »Unser Haus. Ich würde es am liebsten - streicheln. Und den Strand auch - und einfach alles. Ich würde am liebsten sagen: Braves Zimmer, braver Strand, braver Tennisplatz.«
Er lächelte. Das Lächeln bewirkte eine bemerkenswerte Veränderung in seinem sonst eckigen und ein wenig strengen Gesicht.
»Du«, sagte sie. »Wasch die Sachen ab, während ich duschen gehe.«
Captain Merton Heimrich von der Kriminalabteilung der New Yorker Staatspolizei und zur Zeit weit von zu Hause entfernt - nur dass sein Zuhause ihn nun in Gestalt einer schlanken Frau mit ziemlich hohen Schultern und einem schmalen, jetzt sehr braunen Gesicht begleitete -, Captain Heimrich also ging in die Küche und wusch das Frühstücksgeschirr ab. Er hörte die Dusche laufen und dachte an angenehmere Dinge.
Ich bin wirklich zu groß, sagte Merton Heimrich zu sich, als er seinerseits geduscht hatte und sich in der Badehose betrachtete. Ein Glück, dass sie nichts gegen große Lebewesen hat. Worauf er unvermeidlich an einen Hund namens Colonel denken musste. Dies wiederum erinnerte ihn...
»Morgen früh«, sagte Susan ins Telefon, als er ins Schlafzimmer kam. »Und Montagabend zu Hause. Und - nein! Das kann doch nicht wahr sein!«
Sie hörte zu, dann sagte sie: »Das kann’s nicht sein, wenn es das tut«, eine Antwort, die Heimrich einigermaßen rätselhaft war. Er stand da und sah sie an. Sie trug einen knappen Badeanzug. Sie sah sehr hübsch aus im Badeanzug.
»Lass mich mal einen Moment mit deiner Tante sprechen.« Susan wartete einen Augenblick, dann sagte sie: »Emily. Du sorgst dafür, dass er...«
Sie hörte zu. Dann lachte sie. »Schon gut«, meinte sie. »Ich weiß, dass ich das bin.« Sie hörte wieder zu. »Also schön. Er ist wunderbar. Willst du mit ihm sprechen?«
Sie machte wieder eine Pause und lachte wieder und legte dann den Hörer in die Gabel.
»Deine Schwester«, erklärte sie, »hat dir nichts zu sagen, was das teure Geld wert wäre. Es schneit in Van Brunt, aber Michael sagt, dass es eigentlich ganz warm wäre und dass er die ganzen Sachen, die Emily ihn anzuziehen zwingt, überhaupt nicht brauchte. Und sonst sei alles in bester Ordnung. Und Colonel hätte ein Reh gejagt und es nicht erwischt.«
Kann nicht warm sein, wenn es schneit. Natürlich. Das war des Rätsels Lösung.
Es war warm am Strand - am gepflegten, säuberlich geharkten Privatstrand des Palm Haven Motor Lodge and Villas. - South Ocean Boulevard. Direkt am Meer gelegen. Sämtl. Zimmer m. Klimaanlage. Swimming Pool. Restaurant, Cocktail-Lounge, Fernsehen. Gr. Privatstrand. Hunde mitbr. nicht gestattet. - Es war schön am Strand. Alles war schön. Sie lagen auf den Strandmatten, Sonnensegel über den Köpfen. Sie gingen zum Wasser hinunter, schwammen, kamen heraus und lagen in der Sonne und gingen wieder ins Wasser. Wie an jedem Tag seit drei Wochen. Bis auf den einen Tag, an dem es geregnet hatte und sie im Zimmer geblieben waren. Auch für den Tag hätte sie das Zimmer gern gestreichelt.
Tommy Stein, neun Jahre alt und strohblond, kam energisch durch den Sand gestapft und blieb vor ihnen stehen.
»Guten Morgen«, sagte er. »Habt ihr meine Schwester gesehen?« Sie hatten sie nicht gesehen.
»Gut«, sagte Tommy Stein und ging wieder davon.
»Wir hätten Michael mitbringen können«, meinte Susan Heimrich. »Andere Kinder bleiben auch von der Schule weg.«
»Aber«, erwiderte ihr Mann, »wir hätten Colonel nicht mitbringen können. Das Mitbringen von Hunden ist nicht gestattet. Dem Jungen fehlt nichts.« Aber er blickte sie forschend an.
Sie beugte sich herüber und streichelte seine Hand. »Niemandem fehlt etwas«, sagte sie. »Alles ist wunderbar. Deine Schwester kann gut mit Kindern umgehen. Mit großen Hunden übrigens auch. Es war sehr lieb von ihr, nicht?«
»Sie mag das Landleben gern«, entgegnete Heimrich. »Sie mag Kinder gern. Und sie mag dich gern.«
»Ich kriege langsam Hunger«, bemerkte Susan. »Kriegst du auch langsam Hunger?«
Er stand auf, ergriff ihre Hände, die sie ihm hinstreckte, und zog sie hoch.
Hilda Stein war elf Jahre alt und ebenfalls strohblond. Sie sagte: »Mama fragt, ob ihr ein Schreibspiel machen wollt, und habt ihr meinen Bruder gesehen?«
»Vor ein paar Minuten, Hildy«, antwortete Susan. »Er hat nach dir gesucht. Er ging zum Wasser hinunter.«
»Gut«, sagte Hilda Stein und stapfte davon. Sie sahen ihr nach.
»Schreibspiel?«, fragte Susan. »Kein Schreibspiel«, erklärte Heimrich. Sie zogen Strandjacken über, gingen zwei Sonnensegel weiter und sagten: »Kein Schreibspiel« zu Tom und Leona Stein, die ebenso strohblond waren wie ihre Kinder.
»Euer Verstand wird einrosten«, bemerkte Tom Stein.
»Wollen Sie wirklich schon morgen fahren?«, fragte Leona Stein. »Sie sind doch gerade erst gekommen.«
»Er hat Mörder, die auf ihn warten«, meinte Tom. »Stehen schon Schlange. Wollen sich von keinem anderen fangen lassen. Singen im Chor: Wir wollen Heimrich!«
»Wiedersehen«, sagte Heimrich, und sie gingen weiter den Strand entlang.
»Werden wir sie wirklich wiedersehen?«, meinte Susan. »Und alle anderen - die Greshams, die Kennedys. Leute, die wir vor vierzehn Tagen noch nicht gekannt haben. Mit denen wir viele Stunden zusammen waren - gespielt haben. So nette Leute.«
»Sehr nette Leute«, stimmte Heimrich zu.
»Und jetzt - Karten nächstes Jahr zu Weihnachten und vielleicht noch im darauffolgenden Jahr, und dann Sie beendete ihren Satz mit einem leichten Heben der Schultern.
»Alle Dinge haben mal ein Ende«, meinte Merton Heimrich. »Das ist nun einmal so.«
»Und einen Anfang«, gab sie zurück. Was wichtiger ist. Ich habe nicht nur Hunger, sondern auch Durst.«
Rings um das Schwimmbassin standen Tische, und der unter der größten Palme war frei.
»Das hatte ich so geplant«, erklärte Heimrich. Sie streckten die Beine in die Sonne und schlürften eisgekühlte Getränke.
»Das hier ist ein netter Platz zum Mittagessen gewesen«, sagte Susan. »Ich möchte ein Hamburger Steak auf einem getoasteten Brötchen und Kartoffelchips und eisgekühlten Kaffee. Du planst alles wunderbar. Das Wetter kannst du besonders gut.«
»Das ist eben eine Gabe«, erklärte er ihr. »Im Übrigen ist bald der Augenblick für eine wichtige Entscheidung gekommen. Strand oder Tennis?«
»Wir werden es uns durch den Kopf gehen lassen. Es bedarf einiger Überlegung. Einerseits müssen wir uns umziehen, wenn wir Tennis spielen. Andererseits besteht eigentlich kein Grund, warum wir die Greshams nicht schlagen sollten.«
»Nur dass sie zufällig ein bisschen besser sind als wir. Wir könnten natürlich noch einen letzten Versuch machen.«
Sie gingen zurück zu ihrem Zimmer. Unser erstes Zimmer, dachte Susan Heimrich, die noch vor vier Wochen Susan Faye gewesen war. Ein Zimmer wie kein anderes.
Sie zogen sich um. Sie verloren sieben zu fünf gegen Ned und Rachel Gresham. Danach saßen sie im Schatten von Palmen neben dem Tennisplatz und tranken Gin mit Soda.
»Morgen wieder?«, fragte Ned Gresham, worauf seine Frau meinte: »Du bist so vergesslich. Sie fahren doch morgen.«
»Also dann, auf Wiedersehen«, sagte Ned Gresham, als sie ausgetrunken hatten.
Sie gingen den wohlbekannten Fußweg entlang, die Stufen hinauf.
»Die Leute mit dem grünen Cadillac sind auch nicht mehr da«, sagte Susan, als sie vom Balkon hinunterschaute. »Da steht ein neuer Wagen aus Minnesota. Ich wünschte, die Greshams lebten nicht in Idaho. Wir müssen packen, nicht wahr?«
Ehe es ganz dunkel war, fuhren sie in nördlicher Richtung den South Ocean Boulevard entlang. Zuerst war dieser nichts weiter als eine gerade Straße, nichts weiter als die Florida A 1 A. Aber sie wollten ihn getrost South Ocean Boulevard nennen. Das Palm Haven Motor Lodge and Villas hatte es lieber so; das Palm Haven war nett zu ihnen gewesen, da sollte man auch ihm einen Gefallen tun. Zuerst eine schnurgerade Straße mit dem Meer auf der einen Seite und Mauern auf der anderen. Hohe Mauern mit schmalen Einfahrten und dahinter die gequälten Silhouetten der Palm-Beach-Häuser.
Susan, deren Geschmack in eine andere Richtung ging, hatte beinahe ehrfürchtig ausgerufen »Du lieber Gott!«, als sie das erste Mal die Dächer der Palm-Beach-Häuser sah. »Was für Leute leben denn in so etwas?«, hatte sie gefragt, und Heimrich hatte sich eben weit genug zur Seite gewandt, um ihr zuzulächeln, und gesagt: »Reiche Leute, Susan.«
Zwei Palm Beaches, wenn man West Palm Beach nicht dazuzählte: das Palm Beach der großen Häuser und das Palm Beach der Urlauber. Zwei Palm Beaches, die sich berührten - ja, wo berührten sie sich? In den oberen Gefilden des ,Palm Beach Towers'? Oder in den riesigen Räumen des Breakers, wo außerhalb des Speisesaals ein Parkplatz für Rollstühle freigehalten wurde?
»Ich wünschte eigentlich«, sagte Susan, während sie um die Kurven des wirklichen South Ocean Boulevard krochen, »dass wir wenigstens ein Exemplar davon getroffen hätten.«
»Hm«, brummte Heimrich, die Augen auf einen Spiegel gerichtet, der gegenüber der Einfahrt auf der linken Seite in einer Mauer angebracht war. Vernünftige Vorsichtsmaßregel; selbst die sehr Reichen mussten hin und wieder aus ihren Behausungen herauskommen, sich den öffentlichen Straßen anvertrauen.
»Wenn man’s genau nimmt«, meinte er, als sie die Kurve durchfahren hatten, »haben wir einen getroffen. Bedlow. Und seine Frau.«
Das war in der ersten Woche gewesen, bei einem ihrer Ausflüge, in die manchmal märchenhaft genannte und ohne Zweifel einmalige Worth Avenue. So ziemlich jedes Luxusgeschäft von New York bis San Francisco besitzt eine Filiale in der Worth Avenue. Nach einem ausgiebigen Schaufensterbummel waren sie durch eine Arkade gegangen und hatten La Petite entdeckt.
Dort, in der Cocktail-Lounge, waren Sie Mr. James Bedlow begegnet, der groß war und ein bisschen schwer, glatte weiße Haare hatte und etwas über sechzig sein mochte, und Mrs. Ann Bedlow, die ungefähr Anfang Dreißig war ünd ohne jedes Ungefähr sehr schön. Schön, mit einer dunklen Strähne in den silbrigen - nicht grauen, niemals grauen - Haaren und mit einer Pelzstola, die ein Vermögen gekostet haben musste, und einem Kleid, das - den Preis des Kleides zu schätzen, hatte Susan gar nicht versucht.
»Sind Sie nicht Captain Heimrich?« hatte James Bedlow gefragt und sich erhoben. »Von der New Yorker Staatspolizei?«
Es gehört zum Beruf eines Polizeibeamten, sich Gesichter und die dazugehörigen Namen zu merken. So hatte Merton Heimrich ohne jedes Zögern gesagt: »Guten Abend, Mr. Bedlow. Wir sind beide ein ganz schönes Stück von zu Hause entfernt, nicht wahr?«
James Bedlow. Seine Frau Ann - die offensichtlich nicht viel mehr als halb so alt war wie er. Und ein magerer grauäugiger Mann mit einem mageren Gesicht, der Norman Curtis hieß.
»Auf Urlaub?« hatte Bedlow gefragt, nachdem man einander vorgestellt worden war. Heim rieh hatte geantwortet: »Auf Urlaub.« Auf die Einladung, doch einen Schluck mit ihnen zu trinken, hatte er gesagt: »Sehr gern«, und damit war nach dem Drink der Fall erledigt gewesen. Bis auf den Umstand, dass die Bedlows, die, wie sie sagten, die Biddleworth-Villa gemietet hatten, beim Abschied der Hoffnung Ausdruck gaben, Captain Heimrich und seine Frau möchten vor ihrer Abreise doch einmal auf einen Cocktail vorbeikommen.
Als sie an jenem Abend an ihrem Tisch saßen und auf die Scampi warteten, hatte Susan fragend die Augenbrauen hochgezogen.
»Eigentümer des Chronicle«, hatte Heimrich erklärt. »Hat ein großes Haus droben in der Nähe von...«
»Oh«, hatte sie ausgerufen. »Dieser Bedlow!«
Dieser Bedlow war es. Eigentümer eines in den Bergen des Bezirks Putnam gelegenen Landsitzes mit dem schlichten Namen The Hilltop; Eigentümer des New York Chronicle, einer Tageszeitung; Eigentümer von - offenbar reichlich fließenden - Ölquellen in Oklahoma.
Vor etwa einem Jahr war Captain Heimrich überredet worden, einen Vortrag über die New Yorker Staatspolizei zu halten. Bedlow war einer seiner Zuhörer gewesen. Nach dem Vortrag hatte er den Redner zum Trost zu einem Drink in sein Haus The Hilltop eingeladen. Daher...
»Seine Frau ist sehr schön, nicht wahr?« hatte Susan gemeint und gespannt auf seine Antwort gewartet.
»Oh - ja«, hatte Heimrich in einem Ton erwidert, der sie wieder beruhigt hatte.
»Wesentlich jünger. Um Jahre jünger.«
»Seine zweite Frau. Er hat bereits zwei Töchter, die fast in ihrem Alter sind. Schätzungsweise. Ich weiß nicht, wie alt sie ist.«
»Und Mr. Curtis?«
»Chefredakteur des Chronicle«, hatte Heimrich erklärt, worauf ihm gesagt worden war, dass er ja einfach alles zu wissen scheine.
»Na, na, Susan«, hatte er gemeint. »Solche Dinge merke ich mir einfach. Ich habe eben einen Polizistenverstand.«
»Einen sehr netten Verstand«, hatte Susan gesagt. »Ein bisschen langsam, habe ich mal eine - eine ganze Weile gedacht. Aber sehr nett.«
Mrs. Bedlow hatte sie tatsächlich einige Tage später angerufen und zum Cocktail eingeladen. Doch das war der Abend gewesen, an dem sie mit den Kennedys ins Theater gehen wollten. Mrs. Bedlow hatte mit ihrer leisen, ziemlich kehligen Stimme gesagt: »Dann ein andermal«, doch es hatte kein andermal gegeben. Die Zeitung von Palm Beach, die sich mit solchen Dingen befasste, hatte am folgenden Montag mitgeteilt, dass Mr. und Mrs. Bedlow nach New York zurückgekehrt seien. Um ihr Sommerhaus in Westchester County zu eröffnen. Was sogar ungefähr hinkam.
Am Abend dieses letzten Märztages war es im La Petite Marmite viel leerer als vor zweieinhalb Wochen. Sie brauchten nicht zu warten; ihr Lieblingstisch stand sofort zur Verfügung. Doch der Kellner war nicht Henri.
»Der ist schon wieder nach Norden gefahren«, erklärte ihnen der Kellner, der sie an seiner Stelle bediente. »Ich selbst reise auch am Montag ab.«
Die alljährliche Völkerwanderung der Kellner hatte also bereits begonnen.
Zweites Kapitel
Nichts, sagte Dinah Bedlow zu sich, kann ich dagegen tun, ob ich etwas dagegen tun will oder nicht. Sie brauchte nur ihren kleinen Finger zu krümmen, und schon ist es geschehen - sie würde ihren kleinen Finger natürlich sehr elegant krümmen, wie sie alles so elegant tut, wie sie jetzt so elegant die Treppe herunterkommt, obwohl bloß ich zuschaue. Sie würde mit der gleichen Anmut, mit der gleichen Haltung herunterkommen, wenn niemand zuschaute. Das musst du ihr lassen, sagte Dinah zu sich. Sei fair.
Sie saß mit einem Buch am Fenster - ziemlich dicht am Fenster, denn der Himmel war noch immer von Wolken verhangen, obwohl es nicht mehr schneite wie am Morgen und auch der später einsetzende Regen aufgehört hatte. Von dort, wo sie saß, konnte Dinah durch den breiten Türbogen die Treppe sehen, die vom ersten Stock in die Halle führte, und die Frau ihres Vaters, die langsam die Stufen herunterschritt.
Unwillkürlich hob sie die Hand und strich glättend über ihre kurzen dunklen Haare. Erst als ihre Finger das Haar berührten, wurde ihr bewusst, was sie tat, und mit diesem Bewusstwerden kam die leise Enttäuschung über sich selbst, die ihr im Lauf der letzten Woche so vertraut geworden war. Bleib, was du bist, sagte Dinah zu sich. Bleib zerzaust, wenn du zerzaust bist. Vertreib dieses Gefühl der Unzulänglichkeit. Und wenn du schon so fühlen musst, wenn du wirklich ein unschönes Geschöpf bist, dann zeig wenigstens nicht, dass du es weißt. Entschuldige dich nicht dafür, indem du...
»Ganz allein?«, fragte Ann Bedlow und blieb auf der vorletzten Treppenstufe stehen. Mit den Fingern ihrer linken Hand ganz leicht das Geländer berührend, stand sie ruhig da und erweckte doch irgendwie den Eindruck, als ob sie sich noch immer anmutig weiterbewegte.
Und dennoch war es keine Pose. Auch das musst du ihr zugestehen, dachte Dinah Bedlow, während sie lächelnd nickte und dann sinnlos wiederholte:-»Ganz allein.« Man konnte nicht behaupten, dass die Frau ihres Vaters posierte. Es war bloß ihre Art, Ann Bedlow zu sein.
Ann kam die letzten zwei Stufen herunter und ein paar Schritte auf den Türbogen zwischen Halle und Wohnzimmer zu, einem so breiten Bogen, dass er die beiden Räume eigentlich nur symbolisch voneinander trennte. Sie blieb einen Augenblick stehen und lächelte dem junger. Mädchen zu, und gerade in diesem Augenblick fiel ein Sonnenstrahl durch die Glasscheibe der Haustür und leuchtete auf ihrem silbrigen, tadellos frisierten Haar - es war niemals notwendig, dies Haar glattzustreichen - mit der dunklen Strähne, die sich triumphierend von der rechten Schläfe nach oben zog. Selbst die Sonne scheint ihr zu Gefallen, dachte Dinah und lächelte ihrer Stiefmutter zu. Was für eine Bezeichnung für Ann Bedlow!
»Dad ist wohl dort, wo er immer ist«, meinte Dinah, und die ältere - um zehn Jahre? Um acht? - Frau schüttelte zum Zeichen ihrer gemeinsamen Zuneigung zu einem so von seinen Gewohnheiten bestimmten Mann den Kopf.
Es fehlten noch ein paar Minuten bis fünf Uhr an diesem Nachmittag des Donnerstag, dem 31. März. Bis fünf Uhr würde James Bedlow im Bürotrakt des Hauses bleiben.
»Hat Arbeit aufzuholen«, sagte seine Frau, wieder in einem Ton des Einverständnisses mit dem dunkelhaarigen Mädchen am Fenster. »Als würde er nicht immer arbeiten. Sogar in Florida...«
Mrs. Ann Bedlow bewegte die Schultern mit der eleganten Andeutung eines Achselzuckens und drückte durch die Bewegung aus, was in Worten auszudrücken nicht notwendig war.
»Ann«, sagte Dinah, »kannst du ihn nicht dazu bringen, class er anfängt, ein bisschen langsamer zu treten? Schließlich ist er nicht mehr der...«
Doch Ann schüttelte mit betrübtem Lächeln den Kopf. Sie erwiderte: »Das kann ich nicht und ich fürchte, auch sonst niemand.« Ihr Lächeln verschwand. »Nicht, dass ich es nicht schon versucht hätte, meine Liebe. Aber er geht nun mal seinen eigenen Weg, dein Vater. Er...«
Sie hielt inne. Draußen auf der Auffahrt hörte man einen Wagen anspringen. Sie ging zur Tür und blickte durch die große Glasscheibe hinaus.
»Miss Winters fährt los«, meinte sie. »Ich vermute also, dass bald Feierabend sein wird.«
»Bis Norman kommt«, sagte Dinah. »Dann geht’s wieder von vorne los. Ich...« Sie zuckte resigniert die Achseln. »Gehst du so spazieren?«, fragte sie.
Die Frage war mehr oder weniger rhetorisch. Ann Bedlow war zum Spazierengehen angekleidet. Zu einem Spaziergang auf dem Land an einem kühlen Nachmittag im Vorfrühling. Sie trug lange Hosen - und sie kann wirklich Hosen tragen! dachte ihre Stieftochter - und feste Wanderschuhe und eine Wollbluse und darüber eine Sportjacke.
»Ich weiß nicht, was du mit so meinst, Liebes«, erklärte Arm. »Die Sonne kommt heraus und - ich brauche frische Luft.«
Zum Beweis atmete sie tief ein. Dabei hob sich kaum merklich ihr vollkommen geformter Busen. Schade, dass ich kein Mann bin, dachte Dinah. Schade, dass ich bloß ein gehässiges kleines - schade, dass ich nicht Norm Curtis bin. Nur ein eigensüchtiges kleines...
Und aus gar keinem Grund, dachte sie; aus keinem erfindlichen Grund. Ein eingebildeter Stachel in meinem Hirn, das vermutlich ebenfalls nur eine Einbildung ist.
»Ich bleibe nicht lange«, sagte Ann und öffnete die schwere Tür. »Ich werde pünktlich wieder da sein.« Sie drehte sich um. »Glaub mir«, sagte sie, und auf ihrem entzückenden Gesicht lag ein strahlendes Lächeln.
Die kühle Feuchte des ersten Frühlings kam durch die Tür, als Ann Bedlow hinausging. Sie drang bis zu Dinah. Ihre Nasenflügel zuckten. Vielleicht, dachte sie, wäre es ganz angenehm, ein bisschen an die frische Luft zu gehen. Vielleicht hätte ich - andererseits wurde ich ja nicht dazu aufgefordert.
Sie schnaubte ärgerlich über ihre eigenen Gedanken. Als ob sie eine Einladung nötig hätte, auf dem Grund und Boden ihres eigenen Vaters spazieren zu gehen. Sie konnte gehen, wohin es ihr beliebte, in dem riesigen Park, der ein ganz hübsches Stück von Putnam County im Staat New York einnahm und um den James Bedlow, der Besitzer und Herausgeber des New York Chronicle, sorgfältig eine hohe Mauer hatte ziehen lassen. Sie brauchte keine Einladung von dieser wunderschönen Frau, dieser beinahe Gleichaltrigen, die ihr Vater vor drei Jahren geheiratet hatte. Er hat damit einen vorzüglichen Geschmack bewiesen, in jeder Beziehung, sagte Dinah Bedlow streng zu sich selbst. Jedenfalls soviel ich weiß. Was ist denn plötzlich in mich gefahren?
»Hallo!«
Dinah ließ ihren Blick sinken und sagte »Hallo!« zu ihrer Schwester, die nun die breite Treppe herunterkam.
Mary Parsons sah aus wie Dreißig und war Dreißig. Sie hatte die gleichen dunklen Haare wie Dinah und wog etwa zwanzig Pfund mehr, was noch immer nicht viel war, aber, dachte Dinah - und jetzt stelle ich schon wieder Vergleiche an bei ihrem Körperbau doch ein paar Pfund zu viel.
Warum, fragte sie sich, betrachte ich plötzlich alle Menschen - Menschen, die ich seit langem kenne, eine Schwester, die ich Zeit meines Lebens kenne -, als sähe ich sie zum ersten Mal? Weil ich ein Jahr, ein knappes Jahr, fort war? Das ist die einfachste Erklärung. Ein Jahr in Europa mit Tante Grace und vorher die ganze Zeit in der Schule.
»Mein Herr Gemahl«, sagte Mary Parsons, während sie die Treppe hinabstieg - ohne auf der vorletzten Stufe stehenzubleiben - und ins Wohnzimmer kam, »dieser Russ...«
»Kommt er nicht?«
»Oh, kommen tut er schon. Aber nicht vor morgen, oder sogar erst am Samstag. Ein neuer Kunde - vielleicht. Der gesattelt und aufgezäumt und über die Hürden geritten werden soll.«
Mary Parsons benutzte oft Ausdrücke aus der Reitersprache. Vor ihrer Heirat war sie zuweilen die bekannte Reiterin Mary Bedlow genannt worden.
»Was liest du denn da?«, fragte sie, indem sie unvermittelt das Thema wechselte.
Dinah zeigte es ihr. Mary schnalzte tadelnd mit der Zunge und sagte: »O’Hara! Du als unschuldiges junges Mädchen.« Sie blickte ihre jüngere Schwester an. »Oder irre ich mich?«
»Das«, bemerkte Dinah, »geht dich überhaupt nichts an.«
Mary lachte sie freundlich aus und teilte ihr mit, dass sie damit in aller Unschuld ihre Unschuld verraten habe.
»Du!«, schimpfte Dinah.
»Trotz Europa«, fuhr Mary fort. »Wo sich doch wahrscheinlich tausend Gelegenheiten geboten haben.«
»Kein Kommentar.«
»Sagst du! Wo ist Mama?« Sie legte den Ton auf die zweite Silbe. »Auf ihrem täglichen Spaziergang?«
»Ja.«
»Und Norman?«
Es war ein Zufall; nur ein Zufall. Es bedeutete nicht, dass sich auch Mary - Gedanken gemacht hatte.
»Auf dem Weg hierher, nehme ich an«, erwiderte Dinah. »Ich weiß, dass Dad ihn erwartet.«
Mary trat ans Fenster und schaute hinaus. »Es sieht mir aber arg feucht aus da draußen«, bemerkte sie. Dann drehte sie sich um. Dad hält ihn fest an der Kandare, nicht wahr? Mr. Norman Curtis, meine ich. Wenn ich ein Chefredakteur wäre, würde ich auch gern - Chef sein. Du nicht?«
»Steck das Messer weg«, meinte Dinah.
Mary schüttelte den Kopf.
»Kein Messer«, sagte sie. »Russ hat einen Schnitzer gemacht. Und - wie sich inzwischen herausgestellt hat, war das das Beste, was ihm passieren konnte. Oh, damals - aber nicht jetzt. Jedenfalls, es war wahrscheinlich ebenso sehr Dads Schuld wie die von Norm. Die Hand am Ruder.«
Mary Parsons war auch eine begeisterte Seglerin.
»Na, es ist sein Ruder, Mary.«
»Und wie!«
»Was einer der Gründe ist für all dies.« Dinah machte eine Handbewegung, in der das Zimmer und das Haus inmitten des riesigen Parks und ihre Europareise und alles andere inbegriffen waren. »Weil ein tüchtiger Mann sich durch seine Tüchtigkeit hochgearbeitet hat und an dem festzuhalten verstand, was...«
»Schon gut«, unterbrach sie Mary. »Schon gut. Das ist absolut richtig. Und ich kenne ihn schließlich schon länger als du.« Sie wandte sich vom Fenster ab. »Ich habe Hunger«, erklärte sie. »Du nicht?«
Dinah schüttelte mit schwachem Lächeln den Kopf.
»Du Glückliche«, erklärte ihre Schwester. Sie ging hinaus in die Halle und verschwand in einem Durchgang neben der Treppe; einem Durchgang, der zu einer Tür führte und, jenseits davon, über einen Korridor zur Küche. Dinah sah ihr nach. Sie nahm das Buch nicht wieder auf. Mr. O’Hara hatte momentan seinen Reiz für sie verloren. Es war etwas von einem Schuljungen an O’Hara, dachte Dinah Bedlow und sagte gleich darauf zu sich selbst: Wer bin ich eigentlich, dass ich so etwas über ihn denke, wo ich doch selbst erst ein oder zwei Jahre dem Schulmädchenalter entwachsen bin?
Da sie keine Antwort darauf fand, außer dass schließlich jeder denken konnte, was ihm beliebte, gingen Dinahs Gedanken zu Mary. Sie fragte sich, was ihre Schwester und Russel Parsons wohl Gemeinsames in sich gefunden hatten, als sie heirateten, und was sie heute Gemeinsames in sich fanden. Na, es geht mich ja nichts an, sagte sie zu sich.
Plötzlich, dachte sie, bin ich wie ein neugieriges kleines Kätzchen geworden, das in jeden Winkel späht, überall herumschnuppert, sogar an Dingen, die ich bisher einfach als gegeben hingenommen habe. Weil ich so lange fort war und mich erst wieder zurechtfinden muss? Oder weil, da ein Ding auf ungreifbare Weise fragwürdig geworden ist, nun auch auf andere in meinen Augen ein Zweifel fällt?