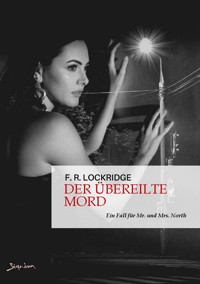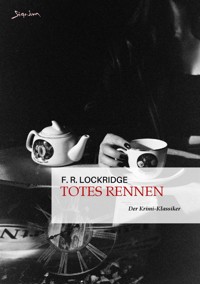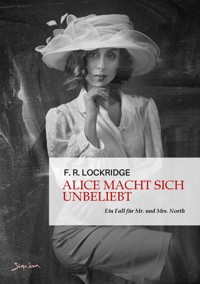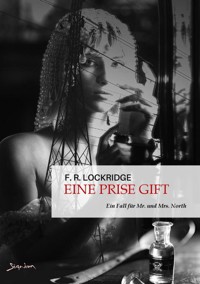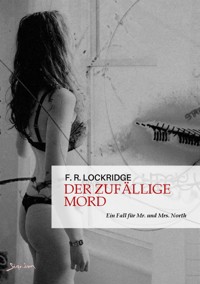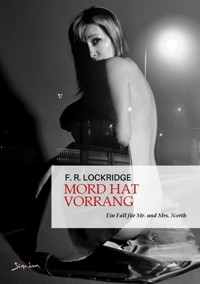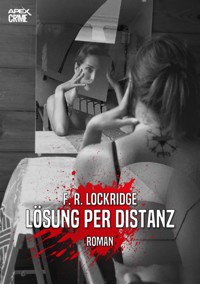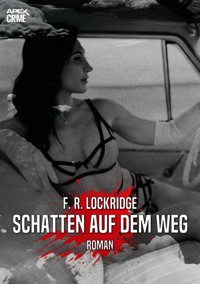
5,99 €
Mehr erfahren.
Allein in ihrem Wagen fährt die junge Carol Sanders von New York nach Florida. Sie will sich nach dem Tod ihres Mannes ein wenig Entspannung gönnen.
Und dann entdeckt sie, dass ihr nicht nur die Schatten der Vergangenheit folgen: Irgendjemand hetzt sie gnadenlos in Wahnsinn und Tod...
Der Roman Schatten auf dem Weg von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1969; eine deutsche Erstveröffentlichung folgte 1970.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
Schatten auf dem Weg
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
SCHATTEN AUF DEM WEG
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Das Buch
Allein in ihrem Wagen fährt die junge Carol Sanders von New York nach Florida. Sie will sich nach dem Tod ihres Mannes ein wenig Entspannung gönnen.
Und dann entdeckt sie, dass ihr nicht nur die Schatten der Vergangenheit folgen: Irgendjemand hetzt sie gnadenlos in Wahnsinn und Tod...
Der Roman Schatten auf dem Weg von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1969; eine deutsche Erstveröffentlichung folgte 1970.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
SCHATTEN AUF DEM WEG
Erstes Kapitel
Der Morgen war kalt und grau. Die Kälte und der Nebel lasteten auf ihr. Sie hatte gehofft, dass die Sonne scheinen würde; dies war ein schlechter Tag, um eine lange Fahrt anzutreten. Es ist fast wie vorher, überlegte sie sich – und versuchte diesen Gedanken wieder zu verdrängen. Aber er ließ sich nicht einfach beiseiteschieben.
Das stimmt nicht, dachte sie. Heute ist nur ein trüber Morgen, und Ende November muss man damit rechnen, dass viele Tage trüb sind. Morgen und übermorgen wird alles besser, weil ich der Sonne entgegenfahre. Das Wetter muss schon heute Nachmittag freundlicher werden. Dieser Morgen ist für jeden scheußlich; der Nebel ist in der Luft, nicht in meinem Kopf. Es ist nicht alles wie vorher.
Auf der Fifth Avenue herrschte noch wenig Verkehr, als sie den Buick mit eingeschaltetem Abblendlicht nach Süden lenkte. Sie fuhr langsam; heute war kein Tag, an dem man raste. Auch auf der Schnellstraße würden überall Leuchtschilder warnend aufblinken: Höchstgeschwindigkeit 45 Meilen.
Sie schaltete das Radio ein. Aus dem Lautsprecher kam eine Männerstimme: »...hören jetzt Nachrichten. Dichter Nebel hat den Flugverkehr an der Ostküste nahezu lahmgelegt. Alle Flüge von und nach Newark mussten ausfallen, Kennedy International und La Guardia melden verspätete Abflüge, und für New York bestimmte Maschinen werden auf Ausweichplätze umgeleitet. Die Verhältnisse werden sich jedoch voraussichtlich im Lauf des Vormittags bessern. In Vietnam haben nordvietnamesische Einheiten amerikanische Stützpunkte bei Da Nang erneut...«
Sie stellte das Radio ab. Der Nebel war auch ohne Vietnam schlimm genug. Sie hielt sich rechts, ließ einen Bus vorbeifahren und bog in die 13. Straße ab, die wie üblich mit Lastwagen verstopft war. Die Bremslichter des Ungetüms vor ihr leuchteten auf, und sie musste ebenfalls scharf bremsen. Toby, der auf dem Rücksitz an seiner Leine lag, miaute kläglich. Aber das tat er fast ununterbrochen, seitdem Frank ihr Gepäck in den Kofferraum gestellt und ihr gute Fahrt gewünscht hatte. Carol drehte sich nach dem Kater um und wollte ihm versichern, er brauche keine Angst zu haben, aber der Lastwagen fuhr an, und sie sah wieder nach vorn.
Sie erreichte die Sixth Avenue und überquerte sie im zweiten Anlauf; dann kam endlich die Seventh Avenue, wo der Verkehr halbwegs flüssig war. Schließlich gähnte ihr der Holland Tunnel entgegen, in dem sie auch diesmal das beklemmende Gefühl hatte, ihr Buick könne plötzlich stehenbleiben, obwohl er noch fast neu war und bisher keine Panne gehabt hatte. Aber für Carol Sanders begann jeder Morgen mit schlimmen Vorahnungen.
Vor ihr veränderte sich das Licht – es wurde nicht heller, sondern nahm eine andere Tönung an. Dort war der Tunnel zu Ende. Der Nebel in New Jersey schien so dick wie der New Yorker zu sein. Sie fuhr in ihn hinaus und hielt an dem Automaten, der ihre Mautkarte für die Schnellstraße ausspuckte. Feuchtkalte Luft und Dieselqualm drangen durch das offene Fenster in den Wagen. Toby protestierte wieder, und sie schloss das Fenster, damit ihr Kater, der nicht nach Florida wollte, es wenigstens warm hatte.
Auf der Zufahrtsstraße zur New Jersey Turnpike herrschte verhältnismäßig wenig Verkehr. Aber als Carol die Einfahrt erreichte, hatte sie den Eindruck, dort rollten die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange mit eingeschalteten Scheinwerfern durch den Nebel. Sie sah eine Lücke, fuhr hinter einem Sattelschlepper auf die rechte Spur und hatte einen weiteren Sattelschlepper links neben sich, während ein Lastwagen hinter ihr gefährlich wenig Abstand hielt.
Sie fühlte sich eingesperrt, konnte ihre Geschwindigkeit nicht mehr selbst bestimmen und hatte das Gefühl, zu schnell, viel zu schnell zu fahren. Die Scheibenwischer richteten kaum etwas gegen den grauen Nebel aus, und Carol bildete sich schon ein, nichts mehr zu sehen – bis sie endlich merkte, dass die Windschutzscheibe von innen beschlagen war. Die Scheibenheizung verschaffte ihr rasch klare Sicht, so dass sie erkannte, welches Fahrzeug vor ihr her rollte.
In die quadratische Rückwand des Sattelschleppers war ein Fenster eingelassen. An beiden Seiten flatterten nasse rote Warnflaggen im Fahrtwind; zwischen ihnen war ein Transparent mit der Warnung Überbreite angebracht. Und darunter las Carol ein anderes Wort, das mit einer Schablone auf das Fahrgestell des Anhängers geschrieben worden war – Porto-Home.
Ausgerechnet dahinter muss ich geraten! dachte sie entsetzt. Dieser scheußliche Zufall muss natürlich mir passieren!
Dann hörte sie den Schrei. Er klang so laut, als sei er unmittelbar neben ihrem Ohr ausgestoßen worden. So laut und so gequält. Aber dieser Schrei erklang nur in ihren Gedanken. Er war das Echo eines Schreis; er war ein erinnerter Schrei.
Sie bremste unwillkürlich. Der Lastwagen hinter ihr begann wütend zu hupen. Carol trat wieder aufs Gaspedal, und der Buick, der seine Geschwindigkeit kaum verringert hatte, nahm seinen vorigen Platz im Windschatten des Sattelschleppers wieder ein. Carol bemühte sich, das Wort Porto-Home nicht mehr zu lesen, aber es befand sich in Augenhöhe, so dass sie es ständig vor sich hatte.
Das Echo des Schreis hallte noch immer in ihren Gedanken nach. Aber dann wurde es schwächer und schien aus größerer Entfernung zu kommen. So war es auch beim letzten Mal gewesen. Dann hörte der Schrei plötzlich auf... wie damals.
Zweites Kapitel
Er war ein ruhiger Mann in einem grauen Anzug – in einem leichten grauen Anzug, weil es an diesem Abend Mitte September noch sommerlich warm war. Bevor es klingelte, hatte sie auf der Couch im Wohnzimmer gelegen, und Emma, die neben ihr auf einem Stuhl saß und ihre Hand hielt, hatte beschwichtigend gesagt: »Regen Sie sich nur nicht auf, Mrs. Sanders. Er kommt gleich und gibt Ihnen ein Beruhigungsmittel, Mrs. Sanders. Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Ma’am...«
Dann hatte es geklingelt. Emma war aus dem Wohnzimmer in die Diele hinausgelaufen – und mit einem Mann zurückgekommen, der nicht der Arzt war. »Sergeant Bronson, Madam«, stellte sich der Mann in dem grauen Anzug vor. »Tut mir leid, dass ich Sie belästigen muss, Mrs. Sanders.« Er warf ihr einen fragenden Blick zu, als sie sich auf der Couch aufzusetzen versuchte. »Sie sind doch Mrs. Sanders, nicht wahr?«
Carol wollte sich aufrichten, hatte nicht die Kraft dazu und sank in die Kissen zurück. »Ja«, antwortete sie mit schwacher Stimme, »ich bin Mrs. Sanders. Mrs. Benjamin Sanders. Ist er...?«
»Tut mir leid, Mrs. Sanders«, beantwortete Sergeant Bronson ihre unausgesprochene Frage. »Er war sofort tot.«
»Er hat geschrien«, flüsterte sie. »Ich habe den Schrei gehört. Ich habe ihn gehört. Ich habe...«
»Ja«, sagte Bronson nur. Er blieb vor der Couch stehen und sah auf Carol hinab. »Ich muss Ihnen einige Fragen stellen, aber ich kann später zurückkommen, wenn Ihnen das lieber ist.« Er wandte sich an Emma. »Sie braucht einen Arzt. Jemand müsste bei ihr bleiben.«
»Ich bin bei ihr, Mister«, antwortete Emma, »und ich habe schon einen Arzt angerufen.«
Bronson nickte und setzte sich auf Emmas Stuhl. »Wir müssen feststellen, was passiert ist, Mrs. Sanders«, fuhr er fort. »Wir müssen einen Bericht darüber verfassen. Aber das hat alles Zeit. Ich kann später wiederkommen. Oder ich kann einen Kollegen schicken.«
»Ich weiß nichts«, murmelte Carol. »Ich habe nur den Schrei gehört. Er... er hat ewig lange gedauert. Dann war er... dann war er plötzlich zu Ende.«
»Ja«, stimmte Bronson zu, »das ist...« Er machte eine Pause. »Waren Sie in der Nähe, Mrs. Sanders? Haben Sie... ihn fallen gesehen? Es war doch nicht dieser Raum?«
»Die Küche«, antwortete Carol. »Das große Fenster in der Küche. Nein, ich... ich habe ihn nicht am Fenster gesehen. Ich war in meinem Zimmer, um mich umzuziehen. Wir wollten mit Freunden zum Abendessen ausgehen. Ich dachte, er sei ebenfalls in seinem Zimmer. Dann habe ich den Schrei gehört. Ich habe nicht gleich an Ben gedacht, aber der Schrei schien aus der Küche zu kommen. Deshalb bin ich hingelaufen. Mehr weiß ich nicht. Mehr kann ich nicht sagen.«
»Tut mir leid, Mrs. Sanders«, sagte der Mann im grauen Anzug, »aber ich muss Sie danach fragen. Ich tue auch nur meine Pflicht, wissen Sie.«
»Sie sollten die Arme vorläufig in Ruhe lassen!«, warf Emma ein.
Sergeant Bronson warf ihr einen fragenden Blick zu.
»Ich heiße Emma Ferguson«, erklärte sie ihm. »Ich arbeite bei den... bei Mrs. Sanders. Mein Zimmer liegt im Erdgeschoss. Es gehört zu diesem Apartment, und ich...«
»Das weiß ich«, unterbrach Bronson sie. »Mr. Harris, von dem wir alarmiert worden sind, hat mir die Zusammenhänge erklärt. Er hat Mrs. Sanders am Fenster gesehen und wollte sie anrufen; als sie sich nicht gemeldet hat, ist er zu Ihnen gelaufen, um Sie nach oben zu schicken.«
»Die Ärmste ist in Ohnmacht gefallen«, erklärte Emma ihm.
»Auf diesen Schreck hin wäre jeder ohnmächtig geworden, Mr. Bronson. Ich habe sie ins Wohnzimmer geschafft und hier auf die Couch gelegt...«
Der Sergeant wandte sich wieder an Carol. »Fühlen Sie sich der Sache gewachsen, Mrs. Sanders? Können Sie mir schildern, was passiert ist? Wir brauchen Ihre Aussage, aber wenn Sie wollen, kann ich auch später wiederkommen.«
»Ich habe in meinem Zimmer am Toilettentisch gesessen«, begann sie leise. »Ich habe mich zurechtgemacht, weil wir mit Freunden ausgehen wollten. Und dann habe ich einen grässlichen Schrei gehört. Ich dachte, er komme aus der Küche, und habe... und habe meinen Mann gerufen – und als er keine Antwort gab, bin ich in die Küche gelaufen. Sie... zeigen Sie ihm die Küche, Emma. Er muss wissen, wo die Küche liegt.«
»Später«, wehrte Bronson ab. »Ich sehe mich später um, Mrs. Sanders. Sie sind also in die Küche gelaufen? Und dann?«
»Das Fenster stand offen. Es ist meistens geschlossen, solange die Klimaanlage arbeitet. Sie ist eingeschaltet, weil es noch so warm ist.«
»Ganz recht«, stimmte der Sergeant zu. »Das Fenster war also offen.«
»Die Vorhänge bewegten sich leicht«, fuhr Carol fort. »Ich habe nichts mehr gehört und bin deshalb ans Fenster getreten. Unter mir... tief unter mir lag etwas. Es war ganz zusammengekrümmt. Und... ich kann es nicht ertragen, aus hochgelegenen Fenstern zu sehen. Ich wollte nicht so hoch oben wohnen, weil ich Angst habe, nach unten zu sehen.«
»Das haben viele Leute, Mrs. Sanders«, warf Bronson beruhigend ein.
»Aber Ben hatte dieses Apartment schon vor unserer Hochzeit«, fuhr Carol fort, »und wir sind deshalb gleich hier eingezogen.«
»Ja, ich verstehe«, murmelte Bronson. »Sie haben also etwas unter dem Fenster gesehen. Was war dann?«
»Mr. Harris, unser Hausmeister, ist auf die Straße gelaufen«, antwortete Carol. »Er... er ist zu... zu Bens Leiche gerannt. Das habe ich doch gesehen, nicht wahr? Bens Leiche?«
»Ja, das war Mr. Sanders’ Leiche.«
»Mr. Harris hat zu mir herauf gesehen. Ich weiß noch, dass er wieder ins Haus gelaufen ist... aber dann setzt mein Gedächtnis aus. Ich bin erst wieder aufgewacht, als Emma sich um mich bemüht hat.«
»Sie waren ohnmächtig«, stellte Emma fest. »Ich habe Sie auf die Couch gelegt und Ihnen kalte Kompressen gemacht.«
»Davon weiß ich nichts«, stellte Carol fest. »Ich erinnere mich nur noch an Mr. Harris. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, Mr. Bronson. Sie heißen doch Bronson, nicht wahr?«
»Richtig, Mrs. Sanders.« Der Sergeant stand auf. »Tut mir leid, dass ich Ihnen das nicht ersparen konnte. Sie haben sich tapfer gehalten. Der Arzt wird Ihnen wahrscheinlich ein Beruhigungsmittel geben.« Er machte eine Pause. »Nur noch eine Frage, die wir in solchen Fällen immer stellen müssen: Wie war der Gesundheitszustand Ihres Mannes? War Ihr Mann in letzter Zeit in ärztlicher Behandlung?«
»Er war immer kerngesund«, antwortete Carol. Sie versuchte sich aufzurichten und schaffte es diesmal. »Was Sie andeuten, trifft bestimmt nicht zu. Es... es war ein Unfall. Er hat das Fenster geöffnet und dabei das Gleichgewicht verloren.«
»Ja, so muss es gewesen sein«, stimmte Bronson zu. »Es gibt keinen Grund, etwas anderes zu vermuten. Darf ich mir jetzt die Küche ansehen, Mrs. Sanders?«
Carol nickte wortlos und blieb auf der Couch sitzen, bis Bronson nach scheinbar endlos langer Zeit ins Wohnzimmer zurückkam.
»Tut mir leid, dass ich Sie stören musste«, entschuldigte der Sergeant sich nochmals. »Aber wahrscheinlich ist damit alles erledigt.«
»Schon gut«, murmelte Carol.
»Jemand müsste bei Ihnen bleiben«, meinte Bronson.
»Ich kümmere mich um sie«, versprach Emma ihm. »Ich bringe sie ins Bett und...«
Die Klingel unterbrach sie. Diesmal kam der Arzt. Es war Dr. Strom. Seine Praxis lag ganz in der Nähe, aber Dr. Strom machte für gewöhnlich keine Hausbesuche. Seine Patienten kamen zu ihm, um ihm ihre Sorgen anzuvertrauen. Carol erinnerte sich daran, dass Stroms Name in ihrem Telefonbuch unter D wie Doktor stand. Deshalb hatte Emma...
»Wie geht es Ihnen?«, fragte Dr. Strom, als Sergeant Bronson gegangen war. »Ziemlich miserabel? Das muss ein Schock gewesen sein.«
»Ich gebe nicht nach«, versicherte Carol ihm. »Ich will nicht wieder damit zu tun haben.«
Strom war ein untersetzter grauhaariger Mann Ende Fünfzig.
Als Carol ihn vor zwei Jahren zum ersten Mal auf gesucht hatte, war sie fast enttäuscht gewesen, weil er keinen Bart trug und ohne ausländischen Akzent sprach. Im Fernsehen waren die Psychiater meistens bärtige Ausländer...
»Nein, damit rechne ich nicht, Mrs. Sanders«, beruhigte Strom sie. »Der Schock dürfte langsam abklingen, meine Liebe. Dann empfinden Sie vermutlich eine seltsame Leere. Habe ich recht?«
»Wahrscheinlich«, stimmte Carol zu. »Alles scheint so... scheint so weit entfernt zu sein. Mein Mann ist tot, Doktor. Hat Ihnen jemand erzählt, dass er aus dem Fenster gestürzt ist?«
»Ja, das habe ich erfahren, Mrs. Sanders«, antwortete Strom und öffnete seine schwarze Tasche. »Ich weiß auch, dass Sie ohnmächtig geworden sind. Haben Sie sich dabei irgendwie verletzt?«
»Nein, gar nicht.«
»Wahrscheinlich langsam zusammengesackt«, murmelte der Arzt. Er griff nach Carols Handgelenk und fühlte ihren Puls, ohne auf die Uhr zu sehen. »Hmmm, könnte gar nicht besser sein«, stellte er fest. Dann zog er den Inhalt einer Ampulle in eine Injektionsspritze auf und erklärte Carol: »Nur ein Beruhigungsmittel, damit Sie schlafen können, meine Liebe. Geben Sie mir Ihren Arm.«
Nachdem Strom Carol die gelbliche Flüssigkeit injiziert hatte, drehte er sich nach Emma Ferguson um. »Haben Sie mich angerufen?«
»Ja«, antwortete sie. »Ich bin Emma Ferguson. Ich arbeite bei Mrs. Sanders.«
»Bringen Sie sie zu Bett?«, fragte der Arzt und stand auf. »Bleiben Sie heute Nacht bei ihr?«
»Natürlich!«, versicherte Emma ihm. »Glauben Sie etwa, ich würde sie allein lassen?«
»Gut, dann ist alles in Ordnung«, entschied Dr. Strom. »Sie können mich morgen anrufen. Oder sie kann es selbst tun. Ihr geht es bestimmt wieder gut.« Er wandte sich an Carol. »Haben Sie das gehört? Sie brauchen keinen Rückfall zu befürchten. Aber wenn Sie wollen, können Sie irgendwann in der nächsten Woche zu mir kommen.«
»Vielleicht...«, flüsterte Carol undeutlich, weil die Spritze zu wirken begann. Sie merkte kaum, dass Emma den Arzt hinausbegleitete und dann zurückkam, um sie zu Bett zu bringen. Sie nahm nur undeutlich wahr, dass jemand sich um sie bemühte.
Als Carol aufwachte, wusste sie nicht gleich, was am Vorabend passiert war. Aber Sekunden später kehrte die Erinnerung zurück, als habe jemand einen Vorhang aufgezogen, und sie bildete sich ein, wieder den Schrei zu hören. Dann kam Emma Ferguson mit einem Tablett ins Schlafzimmer, trat ans Fenster, öffnete die Jalousie und ließ Sonnenschein herein...
Danach gab es viel zu tun. In den folgenden Tagen kam Carol kaum noch zur Besinnung, so viel war zu erledigen. Sie musste Telegramme aufgeben – an Mr. und Mrs. Wilbur Hudson in Vero Beach, weil Maude Hudson Benjamins Schwester war; an Mr. und Mrs. Felix Sanders, weil Felix Bens Bruder war. Das zweite Telegramm erwies sich als unzustellbar, weil das Ehepaar Sanders in Europa war. Carol musste außerdem telefonieren. Eines der vielen Gespräche führte sie mit Ursula Fields, der Werbechefin von Bryant & Washburn, die ihr versicherte, sie könne ihre Tätigkeit in der Firma wiederaufnehmen, wenn sie sich der Aufgabe gewachsen fühle. Carol war erleichtert, als Ursula sagte: »Bei uns ist immer Platz für Sie.«
Die Times, die Post und der Daily Herald, hatten keine großen Meldungen gebracht.
Benjamin Sanders, Präsident der Porto-Homes Corporation, ist gestern nach einem Sturz aus seinem im 9. Stock gelegenen Apartment an der Fifth Avenue gestorben. Die Polizei hält einen Unfall für wahrscheinlich. Porto-Homes stellt Wohnanhänger her und verfügt über Fertigungsstätten in Connecticut, Florida und Kalifornien.
In New York City fallen – oder springen – jedes Jahr zahlreiche Menschen aus Fenstern. Wenn sie jedoch nicht stundenlang auf einem winzigen Vorsprung ausharren, während Feuerwehrmänner, Polizisten, Geistliche und Psychiater sich bemühen, sie von ihren Selbstmordgedanken abzubringen, melden die Zeitungen kaum mehr als ihren Namen und ihr Alter. Benjamin Sanders war 41 gewesen, als er aus dem Fenster im neunten Stock fiel – oder sprang.
Carol Sanders war ihrer Schwägerin Maude Hudson dankbar, dass sie ihr die Erledigung der meisten Formalitäten abnahm. Maude war mit dem Flugzeug aus Vero gekommen und ergriff sofort die Initiative: Sie beauftragte ein Bestattungsunternehmen, erkundigte sich, wann die Leiche ihres Bruders nach der Autopsie freigegeben werden sollte, und saß dann neben Carol in der Friedhofskapelle. Maude war eine Frau, auf die man sich wie auf eine ältere Schwester verlassen konnte.
Sie hatte ein schmales, längliches Gesicht mit hervortretenden Backenknochen; an ihren Bruder Ben, der groß und schwer gewesen war, erinnerten eigentlich nur ihre leuchtendblauen Augen. Maude war einsfünfundsechzig groß – etwa fünf Zentimeter größer als Carol. Sie hatten nebeneinander auf der harten Kirchenbank gesessen, und als sie aufstehen mussten, hatte Maude ihre Schwägerin gestützt, obwohl Carol jetzt keine Hilfe mehr brauchte.
Am Tag nach der Bestattung fuhren Carol und Maude zum Flughafen Kennedy International hinaus, wo Maude die Maschine nach Jacksonville nehmen wollte. Carol hatte den Eindruck, Maude versuche ihr etwas Wichtiges zu sagen – aber Maude versicherte ihr nur, Bill habe es sehr bedauert, dass er nicht hatte kommen und helfen können, aber er sei eben in der Fabrik unabkömmlich, solange Felix sich irgendwo in Italien herumtreibe.
Felix Sanders hatte das Telegramm seiner Schwester erst nach fast zwei Tagen beantwortet. Versuchen Plätze für Rückflug zu reservieren. Um diese Jahreszeit schwierig. Und er hatte Carol telegrafiert: Unser tiefempfundenes Mitgefühl. Vinnie und Felix.
Erst als der Abflug der Maschine nach Jacksonville angekündigt wurde, rückte Maude mit der Sprache heraus. Sie blieb nochmals stehen, um Carol zu fragen: »Was hast du jetzt vor, Liebste? Du willst doch nicht etwa allein in dem großen Apartment wohnen?«
»Das weiß ich noch nicht«, antwortete Carol ausweichend. »Ich muss erst darüber nachdenken.«
»Hat dein Job etwas damit zu tun?«, wollte Maude wissen. »Ich habe mich schon immer darüber gewundert, dass du ihn auch nach der Hochzeit nicht aufgegeben hast.«
»Ben war doch oft geschäftlich unterwegs«, antwortete Carol beinahe schuldbewusst. Dabei hatte Ben wirklich keine Einwände gegen ihre Tätigkeit als Texterin in der Werbeabteilung von Bryant & Washburn gehabt.
»Dabei brauchst du gar keinen Job«, fuhr Maude fort. »Jedenfalls jetzt nicht mehr. Und vorher hättest du auch keinen gebraucht.«
»Mir ist es nicht auf das Geld angekommen«, erklärte Carol ihr. »Ich hatte Spaß an der Arbeit, weißt du. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt tun werde. Müsstest du nicht schon...?«
»Ja, natürlich!« stimmte Maude hastig zu. Sie ging hinter den anderen Passagieren her, blieb noch einmal stehen und drehte sich nach Carol um. »Komm zu uns nach Vero!«, rief sie ihr zu. »Was willst du hier in der Kälte? Hör zu, ich lasse Bens Haus – jetzt gehört es dir – auf Hochglanz bringen, und du...«
»Gut, ich überlege mir den Vorschlag!«, antwortete Carol. »Aber jetzt musst du dich wirklich beeilen, Maude!«
Carol sah ihrer Schwägerin nach, die beinahe rennen musste, um das Flugzeug noch zu erreichen. Dann fuhr Carol mit einem Taxi in das große Apartment an der Fifth Avenue zurück, legte die Trauerkleidung ab, die ihr fast als Maskerade erschien, und kam in einem leichten Wollkleid aus dem Schlafzimmer. Tobermory, der hübsche Siamkater mit dem berühmten Namen, kroch unter einem Bett hervor, um seinen Kopf schnurrend an Carols Bein zu reiben. Solange Maude Hudson im Apartment gewohnt hatte, war Toby möglichst unter den Betten geblieben.
Carol hatte eben in einem Sessel Platz genommen, als das Telefon klingelte. Sie griff nach dem Hörer und meldete sich.
»Hier ist Sergeant Bronson, Mrs. Sanders. Dürfte ich Sie nochmals kurz stören? Ich habe einige Kleinigkeiten aufzuklären.«
»Heute, Mr. Bronson?«, fragte Carol.
»Wenn es Ihnen recht ist. Vielleicht in einer Stunde?«
»Ich...«, begann Carol, machte eine Pause und stimmte dann zu: »Gut, meinetwegen in einer Stunde.«
»Ich störe Sie nicht lange«, versprach Bronson ihr und legte auf.
Carol sah auf ihre Uhr. Kurz nach zwölf. Sie hatte allein zum Mittagessen gehen wollen. Aber das musste nicht unbedingt sein. Emma würde dafür gesorgt haben, dass der Kühlschrank voll war. Carol mixte sich einen Drink, rauchte dabei eine Zigarette und ging dann in die Küche hinaus, um sich ein paar Sandwiches und Kaffee zu machen. Emma Ferguson hatte reichlich eingekauft.
Als Carol nach ihrem improvisierten Mittagessen ins Wohnzimmer zurückkam und sich eine Zigarette anzündete, klingelte es draußen. Seit Bronsons Anruf war genau eine Stunde vergangen. Der Sergeant trug den gleichen grauen Anzug wie beim ersten Mal. Er entschuldigte sich für die Störung, lehnte dankend eine Tasse Kaffee ab und nahm Carol gegenüber auf einem Stuhl Platz, während sie sich in einem bequemeren Sessel niederließ.
»Sie haben neulich erwähnt, der Gesundheitszustand Ihres Mannes sei gut gewesen«, begann Bronson. »Ihr Mann soll sich nicht in ärztlicher Behandlung befunden haben. Stimmt das Ihrer Erinnerung nach, Mrs. Sanders?«
»Ja, Mr. Bronson«, antwortete Carol.