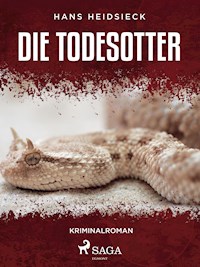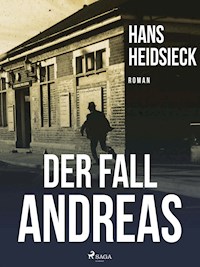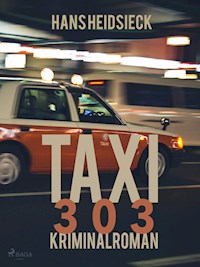Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mary, die Zofe der Harringtons, fährt aus unruhigen Träumen hervor. Irgendetwas ist im Haus nicht geheuer. Draußen vor dem Fenster sieht sie einen Lichtschein verschwinden. Zusammen mit Butler John erkundet sie das Haus. Sie finden den Hund Nero vergiftet, das französische Kindermädchen Jeanette betäubt; wer aber fehlt, ist Percy, der einzige Sohn des Großindustriellen Harrington. Wer kann ihn entführt haben? Und vor allem, Frage der Fragen, wie kann die Familie ihren Sohn lebend zurückbekommen und zugleich die Verbrecher der Gerechtigkeit zuführen? Major Burns und Leutnant Giffry von der Chicagoer Polizei nehmen die Ermittlungen auf. Doch all ihre Bemühungen hätten wohl wenig Erfolg, wenn da Frederick Scott nicht wäre, der spezielle Detektiv der Harrington-Werke mit seinen ganz speziellen Methoden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Wo steckt der kleine Harrington?
Kriminalroman
Saga
Wo steckt der kleine Harrington?
German
© 1936 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508602
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Personenverzeichnis
Thomas A. Harrington, Großindustrieller
Patrizia, seine Frau
Percy, ihr Kind
Wilbur Harrington, Kunstmaler
Miß Mabel Windsor, Harringtons Kusine
John, Butler im Hause Th. A. Harringtons
Mary, Zofe im Hause Th. A. Harringtons
Jeanette, Kindermädchen im Hause Th. A. Harringtons
Geoffrey, Schofför im Hause Th. A. Harringtons
James, zweiter Diener im Hause Th. A. Harringtons
Frederick Scott, Detektiv der Harrington-Werke
Major Burns vom Hauptquartier der Chicagoer Polizei
Leutnant Giffry vom Hauptquasrtier der Chicagoer Polizei
Jean Jacques Delmont, Juwelier
Tom Brown, ein Häusermakler
Jimmy Angehörige der Chicagoer Unterwelt
Patrik Angehörige der Chicagoer Unterwelt
Betty, Patriks Frau Angehörige der Chicagoer Unterwelt
Mellor, ein Privatdetektiv
Mr. Bleens
Der „Meister“
Schwarze, undurchdringliche Nacht hatte den Park in ihren Mantel gehüllt. Gleichmäßig strömte der Regen vom Himmel nieder.
Mary, die Zofe, fuhr aus dem Schlaf empor. Ein wirrer Traum hatte sie aufgestört. Sie tastete nach dem Schalter. Licht flammte auf — sie warf einen Blick auf die Uhr. Es war kurz vor drei.
In kleinen Bächen troff draußen das Wasser an den Scheiben herab. Das gleichmäßig monotone Rauschen des Regens war deutlich vernehmbar.
Mary sprang aus dem Bett, um sich ein Glas Wasser zu holen. Plötzlich verspürte sie einen brennenden Durst. Sie trat ans Fenster und sah hinaus in die Dunkelheit. Dabei schüttelte sie sich unwillkürlich. Es war, als ob sie dadurch den häßlichen Traum von sich abstreifen wollte.
Auf einmal weiteten sich ihre Augen. Was war das? Funkelte da nicht eben ein Lichtschein zu ihr herauf? Nur für den Bruchteil einer Sekunde hatte es aufgeblitzt, dort hinten — jenseits der Rasenfläche — — oder täuschten sie ihre Sinne?
Ein leises Pochen an ihrer Tür. „Fräulein Mary?“ kommt es von draußen. Es ist Johns Stimme. Sie schrickt zusammen. „Ja?“ haucht sie, „was gibt es?“
„Ah — — Sie sind auch bereits wach! Könnten Sie einmal kommen? Ziehen Sie sich etwas an!“
Eine Minute später stand Mary draußen auf dem hell erleuchteten Flur. Vor ihr der alte John, Mister Harringtons treuester und ältester Diener. Sein graumelierter Backenbart schien zu zittern. Aus seinen kleinen, immer etwas verschlafen blinzelnden, aber doch stets hellwachen Augen schaute er ängstlich die Zofe an.
„Verzeihen Sie, daß ich Sie störte,“ sagte er mit verhaltener Stimme, „aber — — ich weiß nicht — — ich habe vorhin Geräusche gehört — — bin auch eben schon das ganze Haus abgegangen —“
„Geräusche?“
„Ja. Irgend etwas ist hier heute Nacht nicht geheuer — —“
„John — — Sie machen mich ängstlich! Auch ich habe schwer geträumt und bin eben wach geworden, und dann — — ja, dann habe ich draußen einen Lichtschein gesehen!“
John trat nervös hin und her. „Wo, bitte, — wo haben Sie den Lichtschein gesehen?“
„Im Park draußen — — jedenfalls war mir so. Und wo Sie nun auch noch kommen, glaube ich kaum, daß es nur eine Täuschung war. Oder sind Sie etwa eben noch unten im Park gewesen?“
„Nein. Im Park war ich nicht.“
„Ja ja, so schnell könnten Sie auch gar nicht wieder hier oben gewesen sein. Aber das Haus haben Sie schon durchsucht?“
John zog einen Revolver aus seiner Tasche. „Ja. Sehen Sie — für alle Fälle habe ich gleich diesen Schießprügel mitgenommen. Vorsichtshalber machte ich auch kein Licht. Ich benutzte nur meine Taschenlampe.“
Mary stand zitternd und fröstelnd da. „Etwas Verdächtiges haben Sie nicht bemerkt?“ fragte sie.
„Nein. Bis jetzt nicht. Aber — ich weiß nicht — — ich bin so unruhig, als müßte doch etwas passiert sein. Als ich eben an Ihrem Zimmer vorbeiging und durch den Türspalt einen Lichtschein bemerkte, erlaubte ich mir, bei Ihnen anzuklopfen. Sonst hätte ich Sie gewiß nicht gestört.“
Es klang wie eine Entschuldigung. Mary lächelte. „Aber John; das war doch sehr richtig von Ihnen. Jetzt, wo die Herrschaft nicht da ist, müssen wir doppelt wachsam sein.“
„Das meine ich eben auch.“ —
„Haben Sie von dem übrigen Personal noch jemand geweckt?“
„Nein. Bisher nicht.“
„James schläft doch mit Ihnen in einem Zimmer. Ist er nicht wach geworden?“
John lächelte. „Nein. Der schläft wie ein Murmeltier. Ist ja auch noch ein junger Mensch; aber ich — ich habe einen sehr leichten Schlaf. Manchmal hat mich sogar der Regen schon wach gemacht.“
Mary fragte, welcher Art die Geräusche waren, die John gehört haben wollte. Er konnte es aber nicht recht erklären. Es war wie ein Scharren und Kratzen, und einmal auch wie verhaltene Stimmen. Der Hund? Nein, der Hund hatte nicht angeschlagen. Wo steckte der überhaupt? In der Vorhalle hatte John freilich nicht nachgeschaut, wo Nero sein Nachtlager hatte. Die Tatsache, daß der Hund nicht anschlug, fand Mary etwas beruhigend. Trotzdem schlug auch sie vor, das Haus noch einmal abzusuchen. John solle James mit zu Rate ziehen. Miß Windsor, die Hausdame, brauche jedoch vorerst nicht geweckt zu werden.
John folgte dem Rat und stapfte mit seinen gewichtigen Schritten davon, um James zu wecken. Mary blieb in der Tür stehen und lauschte den Schritten nach. Sie überlegte, ob man nicht doch auch das übrige Personal wecken sollte. Aber es war wohl besser, nicht gleich das ganze Haus in Aufregung zu versetzen.
Nach knapp zwei Minuten kamen die beiden Diener die Treppe herunter. Trotzdem man ihr abriet, schloß Mary sich ihnen an. James, der ebenfalls einen Revolver verkrampft in der Rechten hielt, machte einen äußerst verstörten und ängstlichen Eindruck. Er war noch ein junger Mensch mit straffen, nicht unintelligenten Zügen.
In dem Kuppelbau des riesigen, prunkvollen Treppenhauses flammte strahlendes Licht auf. Man schritt über die Galerie die mit kostbaren Läufern belegten Marmorstufen hinunter zum Erdgeschoß, um dort systematisch die Absuchung der Riesenvilla in Angriff zu nehmen. John war beim ersten Mal nur flüchtig durch einige Gänge geeilt.
Die Kunstglastür mit den eingelassenen Pfauen zur Vorhalle wurde geöffnet. John rief nach Nero. Nero rührte sich nicht. Plötzlich stieß Mary einen durchdringenden Schrei aus. Das prachtvolle Tier lag, alle Viere weit von sich gestreckt, leblos und mit verglastem Blick vor der Apollobüste, die auf dem kleinen Mosaikbrunnen stand.
Marys Schrei hatte das ganze Haus alarmiert. Türen gingen. Die beiden Hausmädchen und das Küchenfräulein sowie der Koch kamen herbeigelaufen. Durch das Haustelefon hatte man auch den Schofför und den Gärtner im Seitengebäude verständigt. Miß Windsor, die sich selbst wohl nicht aus dem Zimmer traute, läutete Sturm. Das erste Hausmädchen stürmte zu ihr hinauf. Miß Mabel, eine entfernte Verwandte der Harringtons, sehr ältlich, mit verknitterten Zügen und schlohweißem Haar, stand bleich und zitternd vor ihrem Bett. Was denn passiert sei? — stotterte sie; das Mädchen, selber verstört und zitternd, wußte noch nichts. Doch ja, man hatte Nero vergiftet in der Halle gefunden. Jedenfalls nahm man an, daß er vergiftet wurde.
Inzwischen wurde die Suchaktion fortgeführt. John suchte mit dem Schofför und dem zweiten Hausmädchen zusammen die Parterreräume ab. Der Koch und der Gärtner gingen die erste Etage durch und stiegen dann weiter nach oben.
Wer bisher nicht erschienen war, das war Mademoiselle Jeanette, das französische Kinderfräulein, das neben dem kleinen siebenjährigen Percy schlief. Es wurde jedoch zunächst nicht vermißt. Die Aufregung war zu groß, jede der beiden Suchabteilungen war der Ansicht, sie habe sich wohl der anderen angeschlossen.
In den Parterreräumen fand man außer dem toten Hund nichts Verdächtiges. Man stieg in die Kellerräume. Überall flammte das elektrische Licht auf. Die ganze Villa war hell erleuchtet.
Vor der Heizungsanlage fand man einen riesigen Schraubenschlüssel. Es stellte sich später heraus, daß James ihn dort hingelegt hatte. Also auch nichts Besonderes.
Plötzlich vernahm man von oben lautes verzweifeltes Rufen. Alle stürmten wieder hinauf.
Die Gruppe, die oben suchte, hatte plötzlich an Jeanette gedacht. James klopfte an ihre Tür, die von innen verriegelt war. Es kam keine Antwort. Auch an Percys Zimmer klopfte man jetzt. Aber auch da blieb es still. Es nützte nichts, daß James mit den Fäusten gegen die Türen hieb.
Als John dazukam, befahl er Werkzeug herbeizuholen und die Tür zu Jeanettes Zimmer aufzubrechen. In wenigen Minuten war das geschehen. Man drang in das Zimmer ein, voran John mit vorgestrecktem Revolver. Das Licht flammte auf. Alle prallten entsetzt zurück.
Die Französin saß regungslos in einem Sessel, ihr Kopf war nach hinten gesunken. Die Augen waren geschlossen. So sah es aus, als ob sie nur schliefe. James stürzte zu ihr, John brachte den Kopf aus seiner verkrampften Lage. Die Zofe, die einmal einen Krankenkursus mitgemacht hatte, fühlte nach dem Puls der Französin. Alles starrte sie fassungslos fragend an. John stellte verstohlen fest, ob irgendeine Verwundung vorhanden war.
„Sie lebt!“ flüsterte Mary verhalten, „scheint nur betäubt zu sein!“
Inzwischen war auch Miß Windsor mit einem der Mädchen herbeigekommen. Sie stürzte in Percys Zimmer. Das Bettchen des Kleinen war leer. „Percy, Percy!“ rief die Verzweifelte. Der Ruf pflanzte sich fort. „Percy, Percy!“ schallte es jetzt durch das ganze Haus. Man riß alle Schränke auf, stöberte in den Ecken herum, hinter den Vorhängen, suchte im Badezimmer — — nichts, nichts von Percy zu sehen.
John deutete stumm auf das offene Fenster. Aller Blicke folgten dieser Bewegung. Miß Windsor sank blaß in die Arme der Zofe zurück.
„Entführt!“ murmelte jemand. Niemand wußte, wer das gesagt hatte. Aber das Wort schlug wie ein Blitz ein. Von Miß Windsors Lippen kam ein verzweifelter Schrei.
Jeanettes Stirn wurde mit kölnischem Wasser besprengt. Sie schien wieder zu sich zu kommen.
John, der am ruhigsten blieb, eilte ans Telefon. Doch die Leitung blieb stumm und leer. Das Amt meldete sich nicht. „Man hat die Leitung zerschnitten!“ murrte er vor sich hin.
Miß Windsor kam jetzt erst auf den Gedanken, die Polizei anzurufen. John zuckte die Achseln, erklärte, daß er es schon versucht hatte. Vielleicht sei es aber auch gerade gut, daß man nicht anrufen könne.
Da kam das zweite Hausmädchen mit einem Brief an, den es auf dem Schreibtisch von Jeanette gefunden hatte. Der Brief war offen und trug die Adresse des Hausherrn. Miß Windsor riß ihn ihr aus der Hand. In Maschinenschrift las sie:
„Herr Harrington!
Lassen Sie sich nicht etwa einfallen, die Polizei zu verständigen. Folgen Sie nur stets unserem Rat, dann wird Ihrem Percy nicht das Geringste geschehen. Wir werden Ihnen morgen weitere Nachrichten zukommen lassen, und zwar haben wir uns erlaubt, einige von Percys Brieftauben mitzunehmen. Um die Mittagszeit wird eine Nachricht bei Ihnen eingehen.
Zu Ihrer Rückantwort wollen Sie sich bitte wiederum einiger Tauben bedienen. Wir haben zu diesem Zweck einen Korb mit zwölf zuverlässigen Tieren in Ihrem Park bei der großen Eiche für Sie bereit gestellt. Wir machen Ihnen jedoch streng zur Bedingung, daß Sie drei Tauben gleichzeitig fliegen lassen, von denen nur eine die Nachricht in einer Kapsel mit sich zu führen braucht. Außerdem sind die Tauben erst bei der Abenddämmerung, keinesfalls vor neun Uhr, abzulassen. Werden diese Bedingungen nicht von Ihnen auf das Genaueste befolgt, so können wir für das Leben Percys keine Gewähr mehr übernehmen.
Stürzen Sie also Ihr Kind nicht ins Verderben, indem Sie unsere Befehle mißachten!
In aller Hochachtung!
Die Entführer.“
Miß Windsor ließ das Blatt sinken. Sie fühlte sich wie gerädert. Die Tränensäcke um ihre Augen schienen noch schlaffer als sonst zu sein. Mit zitternden Fingern trommelte sie auf das Papier.
Inzwischen war Jeanette zu sich gekommen. Verständnislos starrte sie zunächst die Umstehenden an. Als man ihr zu verstehen gab, was geschehen war, erlitt sie einen Verzweiflungsanfall. Als Südfranzösin sehr leidenschaftlich, wußte sie sich überhaupt nicht zu fassen. „Ich bringe mich um!“ schrie sie, „das überlebe ich nicht. Man wird mich zur Verantwortung ziehen. Lassen Sie mich doch los!“
Man mußte sie mit Gewalt wieder in ihren Sessel zwingen. Die Zofe flößte ihr einen Schluck Rotwein ein. Sie verschluckte sich und spie einen Teil wieder aus. Bald sah es so aus, als ob sie tobsüchtig würde. Zunächst schien es unmöglich zu sein, sie zu befragen, wie eigentlich alles gekommen sei. Immer wieder schrie und jammerte sie dazwischen. „Mein Percy, mein armer kleiner Percy!“ zeterte sie.
Miß Windsor herrschte sie an. „Nehmen Sie sich zusammen, Jeanette! Wir müssen doch hören — — was hat man mit Ihnen angestellt?“
„Ja was — was?“ — stöhnte das Mädchen endlich, „ich weiß überhaupt nichts! Spürte nur, als ich plötzlich erwachte, ein Tuch auf der Nase, wollte mich wehren — — oh — — schrecklich, schrecklich!“
„Dann verloren Sie das Bewußtsein?“
„Ja, ja, so muß es gewesen sein. Es ging alles so schnell. Ich weiß wirklich nichts — —“
Weiter war nichts mehr aus ihr herauszuholen.
Miß Windsor wandte sich jetzt an John. Der alte, mit dem Familienleben der Harringtons gewissermaßen verwachsene Diener war hier der einzige Mensch, mit dem sie alles besprechen mochte. Sie gab ihm den Brief zu lesen. „Wir werden vor allem sofort die Herrschaften benachrichtigen müssen!“ bemerkte sie. Dann, zu dem Schofför gewendet: „Sie müssen sich gleich zu einer Fahrt fertig machen, Geoffrey!“ Sie hatte sich wieder in der Gewalt und vermochte nunmehr zu disponieren. Geoffrey nickte nur zur Bestätigung und eilte davon, um den Wagen fertig zu machen und vorzufahren.
Zu John sagte sie: „Daß mir niemand vom Personal über die Vorgänge hier im Hause etwas verlauten läßt! Es handelt sich um das Leben Percys — Sie haben den Brief gelesen. Schließlich hängen ja auch alle sehr an dem Kinde. Es ist einfach furchtbar!“
John nickte bedächtig. Tränen standen ihm in den Augen. Der kleine Bengel war auch ihm sehr ans Herz gewachsen. Daß so etwas auch noch passieren mußte! Erwürgen könnte er diese Kerle — — Bestien waren das, jawohl, Bestien!
Unwillkürlich hatte er dies halblaut vor sich hingestammelt.
Miß Windsor schritt erregt auf und ab; die Hände auf den Rücken gelegt. Manchmal hatte sie etwas Männliches.
„Ja, also —“ begann sie wieder, „ich möchte in dieser furchtbaren Angelegenheit nicht allein entscheiden. Harringtons müssen sofort benachrichtigt werden. Das meinen Sie doch auch, John, nicht wahr?“
„Sehr wohl, Miß, ich bin ganz der gleichen Meinung!“
„Geoffrey wird also zur Post jagen, das schafft er, wenn er sich eilt, in zwanzig Minuten. Haben Sie Feder und Tinte zur Hand?“
„Nein, Miß, aber ich hole sofort etwas her!“
„Ja, eilen Sie. Ich werde ein Telegramm aufsetzen. Oder soll ich lieber gleich mitfahren, um zu versuchen, mit meinem Vetter persönlich am Telefon zu sprechen?“
„Das würde doch vielleicht besser sein!“
„Ja. — Oh, da kommt Geoffrey schon! Alles fertig?“
Geoffrey trat, die Mütze zwischen den Händen drehend, ein wenig unbeholfen und linkisch näher. Der Wagen stehe bereit, jawohl.
Die Miß rief per Haustelefon in der Küche an, ob der Kaffee nun endlich fertig sei? Währenddessen kam James bereits mit dem Kaffee an. Auch Geoffrey mußte im Stehen rasch eine Tasse trinken. Miß Windsor gab noch einige Weisungen, wie man sich während ihrer Abwesenheit zu verhalten habe; gleich darauf jagte das Auto davon.
*
Der Großindustrielle Thomas A. Harrington, der sich zu einer Konferenz in Indiana aufhielt, wohin ihn seine Gattin begleitet hatte, schrak aus seinem Hotelbett empor. Was läutete nur das Telephon so verrückt — — Himmeldonnerwetter — — noch nicht einmal nachts hatte man seine Ruhe! Er nahm den Hörer. Der Portier meldete sich:
„Herr Harrington — — Sie werden dringend von auswärts, von einer Miß Windsor, verlangt. Soll ich verbinden?“
Harrington schrak zusammen. Windsor? Millie? Es mußte etwas passiert sein!
„Verbinden Sie!“ rief er in den Apparat.
Selbstverständlich hörte auch der Portier, was gesprochen wurde. Er war ein Mann, der seine Chancen zu nutzen wußte. Mit dem Redakteur der Indiana-Post hatte er schon manches gute Geschäft gemacht. Hier schien ein besonders fetter Braten zu winken. Er schmunzelte in sich hinein.
Das Gespräch war zu Ende. „Portier!“ klang Harringtons Stimme wie die eines gebrochenen Mannes, „bitte verbinden Sie mich sofort mit dem Flugplatz! Flugplatz, jawohl!“
Der Flugplatz meldete sich. Eine Maschine? Regulär flog nach Chicago zur Zeit keine ab. Wie, bitte? Ein Extraflugzeug? Jawohl — — in einer halben Stunde kann es startbereit sein.
Harrington, sonst stets die Ruhe selbst, rannte nervös hin und her. Sollte er Patrizia wecken, die nebenan noch ahnungslos schlummerte? Konnte er ihr die Aufregung nicht ersparen?
Wenn er auch sonst nicht allzusehr an seiner Frau hing, im Augenblick fühlte er sich doch mehr als je mit ihr verbunden. Ja, es drängte ihn geradezu, sich mit ihr auszusprechen. Sein Entschluß war gefaßt. Er drückte die Klinke herunter. Trat in den Raum. Schaltete Licht ein. Da lag sie — noch ahnungslos! Eigentlich war sie eine recht schöne Frau! Der blonde Kopf ruhte auf ihrem rechten Arm. Die lieblichen Züge zeigten eine volle Entspannung — — jetzt glitt ein Lächeln um ihren Mund. Sie mochte von Percy träumen — — allmächtiger Himmel — — — er rührte an ihren Arm. „Du — — Patricia!“ flüsterte er. Rüttelte stärker. Sie blinzelte. Dann fuhr sie empor. „Nein — bitte jetzt nicht“, rief sie aus, „es ist ja noch Nacht — — warum weckst du mich nur?“
Er faßte heftig nach ihrer Hand. „Du mußt aufstehen, Liebling, es geht um Percy!“
Mit einem Ruck sprang Frau Harrington aus dem Bett. „Was — Percy? Was ist mit Percy? So rede doch!“
Als er ihr umständlich beigebracht hatte, worum es sich handelte, brach sie in einem Weinkrampf zusammen.
Es kostete viele Mühe, bis sie einigermaßen wieder beruhigt war. In aller Hast kleidete man sich an und fuhr dann zum Flugplatz.
Nach einer halben Stunde startete man in die Nacht auf Chicago zu. Hier ist Geoffrey bereits telephonisch zum Flugplatz beordert worden.
*
Am frühen Morgen brachte die Indiana-Post bereits Extrablätter mit einem Bericht heraus. Alle Menschen rissen sich um die Zeitungen. Es ging wie ein Lauffeuer um. Harringtons Sohn entführt! Jedermann kannte den Industriellen. Oft genug hatte man Bilder von ihm gesehen. Auch mit dem kleinen Percy zusammen war er schon häufiger abgebildet. Harrington war beliebt durch seine hochherzigen Stiftungen, die oft in die Millionen gingen. Chicago zum Beispiel verdankte ihm einen Volkspark, den großen Harrington-Garten.
In der Gesellschaft spielten er und seine bewunderte Frau eine hervorragende Rolle. Jedermann nahm sofort Anteil an dem bitteren Schicksal, das die Familie betroffen hatte. Percy war das einzige Kind des Industriellen. All dies wurde in dem Extrablatt ausführlich breitgetreten.
Auch die Chicago-Tribune brachte bereits einen Bericht. An eine Geheimhaltung des Geschehnisses war also nicht mehr zu denken.
Gegen sechs trafen Harringtons in ihrer Villa ein, die am Michigansee etwa vierzig Kilometer nördlich von Chicago lag. Miß Windsor hatte in ihrer umsichtigen Art inzwischen alles Wichtige angeordnet. Der Gärtner hatte die Telephonleitung wieder zusammengeflickt. Man konnte jetzt also sprechen. Die Polizei jedoch rief man vor dem Erscheinen des Herrn nicht an.
Harrington stand in der Halle. Er überflog den Brief, den die Verbrecher geschrieben hatten. Die Zeilen flimmerten ihm vor den Augen. Er mußte zwei-, dreimal lesen, um zu begreifen. Plötzlich fragte er nach den Tauben. Ja, die Tauben waren sichergestellt. Der Gärtner hatte sie an der bezeichnten Stelle gefunden.
Harrington beugte sich zu dem toten Hund und strich ihm wehmütig über das Fell. „Armer Kerl!“ murmelte er, „hast dran glauben müssen!“
John hatte angeordnet, daß alles so liegen blieb, wie man es vorfand.
Frau Patrizia hatte sich oben schluchzend über das Bettchen des kleinen Percy geworfen. Sie war nicht mehr fortzubringen. Jeanette stand neben ihr und starrte aus gläsernen Augen die Herrin an. Kein Wort des Vorwurfes war gefallen. Aber gerade das traf sie schwerer, als hätte die Frau getobt. Das Schluchzen der armen gequälten Mutter griff ihr ans Herz.
Harrington rief den Privatdetektiv seiner Werke an. Frederick Scott versprach unverzüglich zu kommen.
Harrington erwartete ihn in seinem Arbeitszimmer. Er hatte sich jetzt gefaßt. Aus seinen Zügen sprach die alte Spannkraft und Energie.
Scott kam, groß, breitschultrig, derb. Unter den buschigen Brauen blinzelten seine klugen Augen. Beide Hände ausstreckend, kam er auf Harrington zu. „Armer Freund!“ sagte er. Es war eine Laune von ihm, stets etwas zu familiär zu tun. Harrington zog die Stirn in Falten.
„Also was soll ich machen, Scott?“ fragte er, „hier ist der Brief! Lesen Sie! Ich glaube tatsächlich, es wäre am besten, die Polizei zunächst aus dem Spiel zu lassen!“
Scott las den Brief durch. „Immer dasselbe Theater!“ murmelte er, „Maschinenschrift — hm — — aber sehen Sie, hier — — das A ist beschädigt.“
Er nahm eine Lupe aus seiner Tasche, untersuchte genau. „Jawohl!“ fuhr er geradezu feierlich fort, „das wäre vielleicht schon ein Anhaltspunkt!“
Harrington lehnte sich an den Schreibtisch und zuckte die Achseln. Aber es freute ihn doch, daß Scott gleich ein wachsames Auge hatte.
„Na — und die Polizei?“ fragte er.
Scott blickte auf. Er strich sich über den Schnurrbart. „Polizei? Nein — ausgeschlossen. Oder wollen Sie Percy gefährden? Solche Halunken sind schließlich zu allem fähig. Wollen Sie mir den Fall anvertrauen?“
„Darum rief ich Sie ja!“
„Also gut. Gehen wir an die Arbeit. Ich möchte zunächst den Tatort besichtigen.“
Harrington klingelte John herbei. John übernahm die Führung. Harrington schloß sich an. Scott nahm alles genauestens in Augenschein. Dingen, die andere niemals beachtet hätten, legte er manchmal gerade besonderen Wert bei. An sich lag der Tatbestand ziemlich klar. Es konnte keine großen Schwierigkeiten bereitet haben, durch das offene Fenster hereinzusteigen. Die Leiter dazu hatte man einfach aus dem Schuppen geholt, in dessen oberem Teil der Taubenschlag war. Das hatte man den Verbrechern ja außerordentlich leicht gemacht. Auch die Spuren im Park wurden gefunden. Sie führten über die Mauer zur Straße hinunter, von dort zum See. Offenbar war ein Boot benutzt worden.
Die Besitzung lag einsam. Nachbarn konnte man nicht befragen.
Scott kehrte mit Harrington in das Arbeitszimmer zurück. „Ich muß Sie zunächst noch mit einer ganzen Anzahl von Fragen belästigen!“ sagte der Detektiv. Harrington bat ihn, Platz zu nehmen, und bot ihm eine Zigarre an. „Was heißt belästigen?“ erwiderte er, „reden Sie nur!“
„Sind Sie über Ihr Personal genau unterrichtet, Herr Harrington?“
Der Industrielle rückte nervös hin und her. „Mein Personal? Glauben Sie etwa — —?“
„Möglich ist alles, Herr Harrington! Und da Sie hier eine ganze Anzahl Angestellter besitzen, könnte leicht einer darunter sein, der, sei es nun bewußt oder unbewußt, den Tätern Vorschub geleistet hat.“
Der Industrielle tippte mit einem Bleistift nervös auf die Platte des Tisches. Um seinen scharfen Mund ging ein Zucken.
„So — ja — — na ja. Aber ich kann Ihnen da keine erschöpfende Auskunft geben. Für die Angestelltenfragen ist Miß Windsor verantwortlich. Ich kann mich darum natürlich nicht so sehr kümmern.“
„Vollkommen verständlich, Herr Harrington. Aber Sie können mir doch wohl sagen, welche von Ihren Angestellten noch nicht sehr lange in Ihren Diensten sind?“
„Hm — unser Küchenmädchen und Geoffrey, der Schofför, die beiden sind erst seit kürzerer Zeit beschäftigt. Ich glaube im März traten sie ein, ungefähr beide zu gleicher Zeit.“
„Ah — zu gleicher Zeit?“
„Nicht ganz. Da müssen Sie auch meine Kusine fragen.“
„Miß Windsor?“
„Ja.“
„Hm. Haben Sie vielleicht irgend einen Verdacht — oder eine Vermutung, Herr Harrington?“
„Ich? Wieso? Meinen Sie in Bezug auf das Personal?“
„Ich meine, ob Sie irgend einem der Leute so etwas zutrauen würden, das heißt also, daß er eventuell mit Verbrechern gemeinsame Sache machte.“
„Erlauben Sie bitte, Herr Scott — — ich nehme mir doch keine Leute ins Haus, die — — ich verstehe Sie überhaupt nicht!“
„Na — es könnte doch möglich sein, daß sich beispielsweise irgend jemand schon einmal unzuverlässig gezeigt hat.“
„Wer das tut, fliegt bei mir gleich hinaus.“
„Und was glauben Sie, wer Ihren Nero vergiftet hat?“
„Nero? Wieso — — ja richtig — —“
„Er ist offensichtlich im Hause vergiftet worden!“
Harrington fuhr empor. „Ah — Sie glauben daraus schließen zu dürfen —“
„— zu müssen, Herr Harrington! Wenn man nicht annehmen will —“
„Was?“
„Daß der Hund bereits abends draußen vergiftet wurde und später in der Halle erst einging. Aber dann müßten nach meiner Ansicht schon vorher Vergiftungserscheinungen an ihm beobachtet worden sein. — Wer fütterte denn das Tier immer?“
„Soviel ich weiß: James.“
„Ihr zweiter Diener? Hm — dann werde ich diesen Herrn mal zuerst ins Gebet nehmen. Ich bitte Sie, mir ein Verhör zu ermöglichen!“
„Gerne. Und was werden Sie dann tun?“
„Dann werde ich das gesamte Personal mal unter die Lupe nehmen. Im Übrigen werden wir warten müssen, bis die Brieftaube ankommt.“
Harrington rief sämtliche Angestellte zusammen. Er stellte ihnen Herrn Scott vor und bemerkte, daß dieser den Fall untersuchen werde. Scott werde auch sie, die Leute, über allerlei ausfragen müssen, um vielleicht dadurch einen Fingerzeig zu erhalten, man solle ihm offen und rückhaltlos Auskunft geben.
Während der kurzen Ansprache ließ Scott eifrig die klugen, tastenden Blicke über die Gesichter der Leute streifen. Diejenigen, bei denen er eine Spur von Verlegenheit zu bemerken glaubte, merkte er sich genau. Zunächst nahm er sich James vor. Für seine Vernehmungen wurde ihm ein besonderer Raum zur Verfügung gestellt. Es war ein kleiner, doch sehr elegant eingerichteter Salon, der an das Arbeitszimmer Harringtons grenzte.
James trat etwas scheu in das Zimmer. Er war ein kleiner, aber sehniger und kräftiger Bursche. Unter der etwas gedrungenen Stirn blickten zwei graue, unruhige Augen hervor. Mit hängender Unterlippe hielt er den Mund stets etwas geöffnet, so daß man die kräftigen Zähne sah. Die aufgeworfene Oberlippe zierte ein kurzer, gestutzter Bart.
Einige Sekunden lang ruhte Scotts Blick prüfend auf diesem Mann. „Setzen Sie sich, James!“ sagte er dann. James blickte sich unsicher um. Es kam ihm wie eine Entheiligung vor, wenn er, der Diener, sich auf diese kostbaren Plüschsessel setzen sollte. Schließlich ließ er sich langsam nieder.
„Also erzählen Sie, haben Sie gestern abend im — oder auch außer dem Hause irgend etwas Besonderes beobachtet?“
„Nein“, erwiderte er und rückte unruhig hin und her. Die scharfen Blicke des anderen schienen ihm nicht zu behagen.
„Dann gestatten Sie, daß ich einige präzisere Fragen stelle“, fuhr Scott unbeirrt fort, „Sie sind es doch wohl, der immer die Türe öffnet, wenn jemand ins Haus will?“
„Ja. Meistens.“
„Schön. Hat gestern abend, sagen wir so von sechs Uhr ab noch eine fremde Person das Haus betreten?“
„Ich wüßte nicht.“
„Besinnen Sie sich genau. Vielleicht ein Bettler —?“
„Nein — wirklich nicht, Herr — Herr Kommissar!“
„Rauchen Sie übrigens? Hier — bitte!“ Scott hielt dem Mann ein silbernes Zigarettenetui hin. James blickte sich wieder scheu um. Er schien befangen. Hier in den geheiligten Räumen der Herrschaft sollte er auf dem Plüschsessel sitzen und rauchen? Aber Scott drängte ihm die Zigarette geradezu auf. Dann fuhr er fort:
„So — also Ihrer Ansicht nach hat um die genannte Zeit kein Fremder den Park betreten?“
„Den Briefträger rechnen Sie doch wohl nicht als Fremden?“
„Nein. — Hm — — wo befand sich der Hund um die genannte Zeit?“
„Er lag vor dem Haus an der Kette. Um fünf Uhr wird er stets angekettet. Herr Harrington wünscht es so.“
„Vorher lief er frei im Park herum?“
„Ja.“
„Sie haben das Tier noch abends gefüttert?“
„Ganz recht. Er bekam seine Knochensuppe mit Kartoffeln und Gemüse darin.“
„Fraß er mit Appetit?“
„Wie immer. Ich habe nichts Besonderes an ihm bemerkt“.
„Warum sehen Sie mich nicht an?“
„Aber ich sehe Sie doch an, Herr, Herr Kommissar!“
Das Verhör ging weiter. Scott machte sich von Zeit zu Zeit eine Notiz. Er hatte noch tausend Fragen zu stellen.
Auf dem Hauptpolizeiamt Chicagos bat der Chef den Leutnant vom Dienst auf sein Zimmer. Der junge Polizeioffizier salutierte. Major Burns winkte ab. „Ich sehe eben durchs Fenster“, bemerkte er grüßend, „da wird ein Extrablatt ausgegeben. Holen Sie bitte mal eins herein!“
„Ich habe bereits eins in der Tasche, Herr Major!“ erwiderte der Leutnant und reichte das Blatt hin, „es handelt sich um die Entführung von Harringtons Söhnchen.“
Der Major fuhr empor. „Ah — wie — — was — — —? Harrington — — — und davon ist hier noch nichts gemeldet worden? Warum wissen wir nichts davon?“
Das borstige, kurz geschorene Haar des Majors sträubte sich. Er sah wie ein Igel aus. Seine Stimme klang messerscharf. Es war, als duckte sich der Leutnant, der jetzt erwiderte:
„Uns ist bisher weder offiziell, noch privat etwas mitgeteilt worden!“
Burns trommelte auf den Tisch. „So. Nichts mitgeteilt! Aber die Zeitung, die weiß natürlich bereits Bescheid! Unerhört, so etwas! Harrington hat uns nicht zu Hilfe gerufen! — Zeigen Sie her, das Blatt!“
Burns überflog die Zeilen. Seine Stirn umdüsterte sich. „Wahrscheinlich“, bemerkte er dann, „werden die Gauner wieder zur Bedingung gemacht haben, daß wir aus dem Spiel bleiben müssen. Die Fälle haben wir ja schon öfter gehabt.“ Er griff zum Telephonhörer: „Hallo — verbinden Sie mich mit der Villa des Industriellen Harrington. Jawohl! Aber sofort! — — ich werde eben mit Harrington sprechen. Haha — — die Polizei bietet sich selber an. Aber ist das nicht unsere Pflicht, Leutnant Giffry?“
„Jawohl, Herr Major!“
Das Telephon läutete. — „Ist dort Harrington? — — Ah, guten Morgen, Herr Harrington! Warum so schüchtern? Wie bitte? Ah — — — nicht an uns wenden! Natürlich! Haben Sie ja auch nicht getan. Wir wenden uns ja an Sie! Ich möchte doch mal mit Ihnen sprechen. Braucht nicht gerade in Ihrer Villa zu sein. Auch hier nicht, nein, nein, falls Sie beobachtet werden. — — Mithören? Ach Unsinn, wer soll hier jetzt mithören? Höchstens eine Beamtin — — und die hält den Mund. Muß ihn halten. Sonst fliegt sie. — — Ja, also